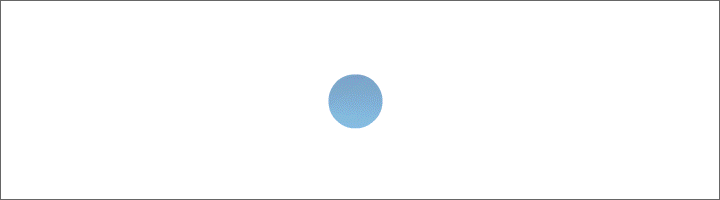Die Schlacht bei Lenzen vom 4./5. September 929
Alle bisherigen powerpoint Präsentationen:
https://www.facebook.com/groups/699132707828393
Die Schlacht bei Lenzen
Slawische Stämme kämpfen an der Elbe gegen ein kleines Heer des Sachsenkönigs Heinrich I
Wir schreiben den Morgen des 04.09.929 nach Christus. Ein kleines Heer von ca. hundert bis zweihundert sächsischen Soldaten belagert auf der rechten Elbseite eine Slawenburg, die von Angehörigen des Stammes der Linonen (1) bewohnt wird. Im Laufe des Tages kommt es zu einer verheerenden Schlacht zwischen den Sachsen und slawischen Völkern, welche sich zum Kampf zu einem großen Heer zusammengeschlossen haben. Geschichtsquellen, wie der Corveyer Mönch Widukind von Corvey, sprechen sogar von 200 000 heidnischen Slawen, die an diesem Tag ihr Leben auf dem Schlachtfeld an der Elbe zwischen Wustrow, Lenzen-Neuehaus und Ferbitz ließen. Die Anzahl erscheint für die damalige Zeit maßlos übertrieben, aber es hat einen Kampf gegeben und es wurden auf beiden Seiten Menschen getötet. Wo diese ihre letzte Ruhe gefunden haben, was mit den Überlebenden geschah und wie es überhaupt zur Auseinandersetzung kommen konnte, werde ich erarbeiten.
Geschichtlicher Hintergrund:
Die Elbe trennt zu dieser Zeit Slawen(2) von den Sachsen(3). An einigen Stellen des ungezähmten Flusses, der mancherorts 12 Kilometer breit sein kann, gibt es die Möglichkeit der Überquerung. Die Linonenburg liegt an einem solchen Übergang, der bereits zur Zeit der Römer(4) bekannt war.
Auf der linken Elbseite erhebt sich eine Insel, die von der letzten Eiszeit geformt wurde. Die Römer unter dem Großneffen des Kaisers Augustus, Claudius Germanicus, erreichten die Elbe um 14./15 nach Chr und errichteten dort eine Grenzfeste. (5) Die Anhöhe wird Hohbuoki genannt, das zweitausend Jahre später den Namen Höhbeck trägt. (6)
Ein weiteres Castell auf dem Höhbeck wurde um 808 durch Karl den Großen errichtet (768-814), beim Kampf gegen die Slawen zerstört und um 811 wieder aufgebaut. (7)
Auch der Ort, an dem die Linonenburg liegt, ist namentlich bekannt. Ein Mönch des Klosters Corvey, Widukind von Corvey (8) (925/935 bis 973), benutzt um 967 den Namen Luncini, der sich später zu Lenzen wandeln wird.
Widukind von Corvey schreibt in den Jahren 967-968 und 973 die Sachsengeschichte und wird ein wichtiger Zeitzeuge.
Sein Problem:
Die Geschichtsschreiber der damaligen Zeit schrieben keine an den Fakten orientierten Dokumentationen, wie wir sie heute kennen. Zum einen waren sie bei den Schlachten in der Regel nicht dabei und konnten viele Jahre später nur noch auf Erzählungen von Soldaten oder anderer Zeitzeugen zurückgreifen und andererseits waren sie, wie der Corveyer Mönch, von ihrem Landesherrn abhängig und verfassten ihre Berichte in deren Auftrag. Negatives kam nicht gut an.
So auch Widukind, der seine Sachsengeschichte der erst 13 jährigen Enkeltochter Heinrichs I und Tochter Ottos I, Mathilde (9) widmete. Mathilde wurde im zarten Alter von zwölf Jahren bereits Äbtissin von Quedlinburg.
Ein weiterer Chronist war Bischof Thietmar von Merseburg. (10) Ihm werden wir noch begegnen.
Auch die Quedlinburger Annalen (11) der dortigen Mönche und die Verbrüderungsbücher(12) z. b. von St. Gallen, Salzburg und Reichenau geben schriftliche Zeugnisse aus dem zehnten Jahrhundert. Ebenfalls die Nekrologen, also die Kirchenbücher, in denen Verstorbene eingetragen wurden, wie das Nekrolog der Kirche von St. Michael in Lüneburg, in dem Todesfälle ab 900 erwähnt sind. (13)
Quellen
1de.wikipedia.org/wiki/Linonen
2de.wikipedia.org/wiki/Slawen
3de.wikipedia.org/wiki/Sachsen
4de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Germanischen_Kriege
5de.wikipedia.org/wiki/Germanicus-Feldz%C3%BCge#R%C3%B6mische_Kriegsziele_und_-strategien
6 de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hbeck
7de.wikipedia.org/wiki/Vietzer_Schanze
8de.wikipedia.org/wiki/Widukind_von_Corvey
9de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_(Quedlinburg)
10Die Chronik des Thietmar von Merseburg, uebers. von M. Laurent - b009173.pdf
11de.wikipedia.org/wiki/Quedlinburger_Annalen
12Verbrüderungsbuch – Wikipedia
13de.wikipedia.org/wiki/Nekrolog_der_Kirche_St._Michael_in_L%C3%BCneburg
Über Einzelheiten und Abläufe der Schlacht, die politischen Hintergründe dazu, Abstammung und Leben der beteiligten Personen, erfahren wir im Laufe dieses Berichts. Ich gehe in die Ursprünge und in die geschichtlichen Abläufe hinein und versuche die Beziehungen der Akteure untereinander darzustellen. Dabei sind Zeitsprünge nicht zu vermeiden und es kann teilweise verwirrend werden. Aber so ist unser Leben und daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Die meisten Bürger durchschauen die politische Lage der Gegenwart nicht und niemand kann in die Zukunft sehen. Wir haben jedoch das Glück, dass Geschichte vergangen ist und wir für die Erarbeitung der Umstände, die zur Schlacht bei Lenzen 929 führten auf dieses Wissen zurückgreifen können. Das unterscheidet uns von den Menschen damals. Zusammenhänge rückwirkend, z. b. die Abstammung eines Bischofs über die Linie der Vorfahren rückwärts herauszufinden, ist nicht schwer. Es erwarten uns spannende Erkenntnisse. Mit Hinweisen auf diejenigen Quellen, die für mich im Netz und in den Büchereien frei verfügbar sind, versuche ich diese zu belegen, so dass einiges vielleicht wissenschaftlich nachvollziehbar wird.
Das Interesse an Geschichte wurde bei mir schon in der Schulzeit geweckt, schlief jedoch im Lauf des Lebens etwas ein. Als ich im November 2021 einen Vortrag über Ausgrabungen in der Nähe meines Wohnortes Gorleben hörte und erstmals von der Schlacht bei Lenzen erfuhr, kam es zu einer Neuauflage. Ich begann zu recherchieren und musste feststellen, dass ich mir ein sehr umfangreiches Thema vorgenommen hatte. Und das, obwohl ich eigentlich nur die Grabstellen der damals umgekommenen Soldaten finden wollte.
Die eingangs erwähnte LInonenburg wurde inzwischen wissenschaftlich als Lenzen-Neuehaus lokalisiert. Dies ist ein bewaldeter Bereich, der sich ca. drei Kilometer von dem kleinen Ort Lenzen entfernt befindet. Lenzen liegt an der Elbe zwischen Dömitz und Wittenberge. Untersuchungen ergaben die Datierung der Zerstörung von Neuehaus durch einen Brand auf 929. Die Burg Lenzen wurde erst 950 erbaut. Das stellte man bei der Datierung der im Untergrund gefundenen Holzbalken fest.
Ich bin durch die überwucherten und fast unzugänglichen Reste der Wallanlage von Lenzen-Neuehaus gewandert, habe Fotos gemacht und mir die Situation der Bewohner während der Zeit der Belagerung und der Schlacht vorgestellt.
Die Burg Lenzen-Neuehaus
Hier könnte das Heer Heinrichs gelagert haben
Lenzen- Neuehaus liegt zwischen Elbe und Löcknitz. Das Elbauengebiet war damals nicht eingedeicht und beide Flüsse konnten sich ungehindert ausbreiten. Es gibt nur wenige Stellen hinter der Löcknitz, die vom Heer Heinrichs als Belagerungsplatz eingenommen werden konnten. Der Platz musste so gewählt sein, dass er die Burgbewohner zu jeder Zeit daran hinderte, auszubrechen.
Der Kampf zwischen Heinrichs I Soldaten und dem slawischen Entsatzheer hat irgendwo auf freiem Feld in der Nähe der heutigen Dörfer Wustrow und Ferbitz stattgefunden. Mit google earth kann man nach Bodenauffälligkeiten suchen, die auf Grabstellen der gefallenen Kämpfer am Schlachtfeld hinweisen können.
Hundert Jahre nach der Schlacht um 1047 erbaute Gottschalk, ein Nachkomme des obodritischen Slawenfürsten Nakon in Lenzen ein Kloster. Klöster waren damals wichtige Orte, an denen für amtierende Könige und ihre Familien sowie für die Seelen der Toten gebetet wurde. Auf dem Marsfeld und auf Gotland wurden Schlachtenmassengräber in der Nähe dieser Klöster gefunden. Im Analogieschluss glaube auch ich auf Grabstellen gefallener sächsischer Soldaten aus der Zeit von 929 zu stoßen, wenn ich das Gottschalk Kloster lokalisiert habe.
Von Nakon wissen wir, dass er Wichmann II und Ekbert, Neffen des Billunger Grafen Herrmann, Asyl gewährte, weil die sich von ihrem Onkel um ihr Erbe betrogen fühlten. Obwohl Herrmann Billung vom Nachfolger und Sohn Heinrichs I, Otto, als princeps militiae, also als oberster Heerführer autorisiert wurde in das Land Nakons auf der anderen Elbseite einzumarschieren, tat er dies nie. Es gab möglicherweise lang zurückreichende Beziehungen zwischen dem Slawenreich der einst heidnischen Abodriten und den christlichen Billungern von Seiten deren Vorfahren. Nakons Urenkel Gottschalk war bereits Christ, was ihn das Leben kostete, denn er wurde von einem Stammesgenossen in Lenzen umgebracht.
Der junge König Otto I überraschte nach seiner Thronbesteigung 936 durch eine völlig neue Ämtervergabe, überging dabei altgediente Grafen und Fürsten seines Reiches. Sein unverständliches Handeln führte zum jahrelangen Zwist mit seinen Brüdern Tammo und Heinrich jun und endete für Tammo in einer Katastrophe. Ich will herausfinden, ob die Schlacht bei Lenzen und die Hintergründe, die zu dieser Schlacht führten, ursächlich für das spätere Verhalten Ottos gewesen sein können.
Hier machen wir einen Schnitt, denn noch können wir nicht wissen, wer die Personen waren, die bereits angesprochen wurden.
Ich beginne jetzt von vorn. Dazu gehört die Geschichte der Besiedlung Sachsens, die lange Zeit vorher begonnen hatte.
Sachsen
Das Volk der Sachsen ist um 400 n Chr gesichert, lebte im Nordwesten Deutschlands und breitete sich bis in die Niederlande aus. (1) Sie wurden mit der Taufe ihres Stammesherzogs Widukind 785 dem Frankenkönig Karl unterworfen. Widukinds Name wird erstmalig 777 auf der fränkischen Reichsversammlung in Paderborn erwähnt. Er war ein erbitterter Gegenspieler Karls, welcher die Eresburg und die heilige Stätte der Sachsen, die Irminsul, zerstören ließ. (heutiger Hochsauerlandkreis) (2)
Die Sachsenkriege endeten um 804.
Kernland der Sachsen auf dem Kontinent war um 880 als Stammesherzogtum Engern (Grablege Widukinds, noch nicht wissenschaftlich gesichert), welches das Weser/Aller Leinegebiet und das östliche Sauerland umfasste. (3)
Dazu Westfalen, bis zur friesischen Grenze, Ruhr/Lippe/Ems, Osnabrück und Minden, Ostfalen, Harz/Magdeburg, Braunschweig, Nordalbingien (Albin bedeutet Elbe), Dithmarschen, Stormarn und Holstein.
Bereits um 477 besiedelten die sächsischen Stämme auch Britannien. Das sächsische Christentum ist dort für 596 belegt. Die Namen Sussex, Essex und Wessex weisen noch heute darauf hin.
Einer Sage nach, sollen die Brüder Hengest und Horsa aus der Nähe Harsefelds, welches im Mittelalter Rosenfeld genannt wurde, nach Britannien ausgewandert sein. Rosenfeld steht für Rossenfeld und hat nichts mit den Blumen zu tun, sondern mit dem Wort Ross für Pferd. Englisch „horse.“
Der gemeinsame Grundwortschatz der Sachsen lag bis ins 10.Jahrhundert mehr im Altenglischen als im Althochdeutschen. Erhalten hat sich dies bis heute in den Dialekten des „Platt-“ oder Niederdeutschen.
Ein bedeutender König regierte um 634-642 den Osten Britanniens, Northumbria, genannt. Er hieß Oswald, starb mit 38 Jahren in der Schlacht von Maserfield gegen den letzten heidnischen Herrscher Penda von Mercia, der ihn zerstückeln ließ. Oswald wurde deshalb als christlicher Märtyrer verehrt, zumal er auch viele Klöster stiftete. Die katholische und anglikanische Kirche feiert ihn als Heiligen am 5. August.
Oswald ist Schutzpatron der englischen Könige, der Kreuzfahrer, des Viehs, der Schnitter und des Schweizer Ortes Stadt und des Kantons Zug. Im Mittelalter wurde eine Wallfahrtskirche in der Diozöse Speyer mit Schädelreliquien von ihm nachgewiesen, Teile seines Kopfes befinden sich im Dom zu Paderborn. (4)
Die spätere Braut Ottos I, Edgitha, soll eine Nachkommin dieses Oswalds gewesen sein. Ottos Verlobung mit Edgitha im September 929 steht mit der Schlacht bei Lenzen in Zusammenhang.
Quellen
(1) http://www.geschichte-online.info/04_04_Sachsen.pdf
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/txt/beitrwff-9578.pdf
https://www.mathematical.com/engernwarnechin753.html
https://www.zeitlebenszeiten.de/html/widukinde.html
Geschichte Widukinds und seiner Nachfahren
Widukind war ein erbitterter Gegner des Frankenkönigs Karl (750-814)
Widukinds Vater war Warnechin von Engern, (ca 705-768), Mutter Kunhilde von Rügen, deren Mutter hieß Gersvinde.
Widukinds Schwester Imhild (Inger)war mit Harald von Haithabu verheiratet. Zu dessen Bruder Sigfried, König von Dänemark, floh Widukind während der Kriege gegen Karl. (1)
Quellen
( 1) http://www.geschichte-online.info/04_04_Sachsen.pdf
https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/txt/beitrwff-9578.pdf
https://www.mathematical.com/engernwarnechin753.html
https://www.zeitlebenszeiten.de/html/widukinde.html
Seine jüngste Tochter Gersvinde war erst drei Jahre alt, als sie von ihren Eltern als Geisel an Karl (den Großen) abgegeben werden musste. Sie soll mit 25 Jahren eine der zahlreichen Konkubinen Karls werden und ihm eine Tochter namens Adaltrude schenken.
Widukinds Frau hieß Geva von Haithabu. Sie wurde um 755 geboren und starb um 807. Sie kann nicht die Tochter König Sigfrieds gewesen sein, da dieser auch um 755 geboren wurde und bereits 798 starb. Geva war mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schwester Sigfrieds und dessen Bruders Harald. Dieser wurde zweiter König nach Sigfrieds Tod.
Er war mit Widukinds Schwester Imhild von Engern verheiratet, die ihm drei Söhne schenkte. Von ihnen stammen die folgenden Generationen der Dänenkönige ab: Halfdan Haraldson, Harald Haraldson, Holger Haraldson. (2)
(2)https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nig_von_Haithabu
https://de.wikipedia.org/wiki/Gudfred https://www.wikiwand.com/de/D%C3%A4nische_Mark
https://www.mathematical.com/ingernimhild745.htmlhttps://www.histsem.unikiel.de/de/das-institut-1/abteilungen/geschichte-nordeuropas/tagungen/811-2011-1200jahre-deutsch-daenische-grenze.-aspekte-einer-nachbarschaft
Widukind und die Immedinger
Widukind hatte noch weitere Geschwister, die wir heute nicht belegen können.
Seine Kinder jedoch sind zum Teil durch Stiftungsurkunden und Eintragungen in den klösterlichen Verbrüderungsbüchern sowie Nekrologen bezeugt. (1)
Da viele verwandtschaftliche Beziehungen namentlich auf Widukinds Nachfahren hinweisen, aber nicht sicher zugeordnet werden können, ist die Dunkelziffer der Widukindischen Sippen groß.
Widukind besaß Besitz in Enger, dies besagte schon der Name seines Vaters Warnechin von Engern. (Angrivarier)
Widukind soll in der Stiftskirche begraben worden sein. Man hat einen Epitaph mit seinem Bildnis aus dem Jahre 1100 gefunden, sowie bei Grabungen drei Gräber mit männlichen verwandten Personen, die um das Jahr 800 beigesetzt worden waren. (2)
Dies könnten zeitlich er selbst, sein Vater Warnechin und sein Sohn Wigbert (starb um 834) sein. Heinrichs I Ehefrau, Königin Mathilde (896-967), gründete als Witwe 947 dort ein Kollegiatsstift und war oft zugegen. Die Ländereien galten als der Besitz ihres Vaters Thiatrich. Einen Mann mit Namen Thiatrich oder Dietrich findet man an der Seite einer Wendin mit Namen Dobrogera unter den Ahnen Widukinds. (3)
Zur Namensgebung: Da es noch keine Nachnamen gab, wählte man Vornamen als Leitnamen, die immer wieder in der Sippe vererbt wurden. (OttoI, II, III) Ottonen, Liudolfinger, Ekbertiner, Billunger etc.) (4)
Obgleich Mathilde mit ihrem Sohn Otto I in Streit lag, beschenkte dieser das Stift großzügig und stellte es nach Mathildes Tod sogar unter die Aufsicht seines neu gegründeten Bistums Magdeburg. Zwischen Widukinds Tod und Ottos Regierungszeit liegen ca. 160 Jahre. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfahren die Grablege ihres berühmten Ahnherrn noch kannten. Anders ist das Verhalten Ottos, der sich wegen der Thronfolge mit seiner Mutter überworfen und ihr die vom Vater 929 geschenkten Besitztümer wieder entzogen hatte, nicht zu erklären.
Verwandtenlinien, die sich auf Widukind gründen, nannten sich später Immedinger. Eine Nachfahrin soll die junge Mathilde gewesen sein, die vierzehnjährig um 909 mit dem dreiunddreißigjährigen Sachsenkönig Heinrich I verheiratet wurde. (5)
Mathilde trug den Namen ihrer Großmutter, die nach dem Tod ihres noch unbekannten Mannes als 4. Äbtissin das Kloster Herford leitete, in dem die Königin Mathilde erzogen und auf ihre weltlichen Aufgaben vorbereitet wurde. (6)
Die Herkunft der bisherigen und folgenden Äbtissinnen Herfords weist allesamt auf hohe Abstammungen hin.
Das Kloster Herford wurde vom sächsischen adligen Waltger um 789 als Eigenkloster gegründet. Es war durch Kaiser Ludwig dem Frommen (Sohn Karls des Großen) zur Reichsabtei erhoben worden. Ludwig gab Herford Güter, die für das Männerkloster Corvey vorgesehen waren.
Zwei Äbte Corveys, die beiden Brüder Wala und Adalhard richteten Herford für ihre Schwester Theodrada von Soissons (genannt Tetta) ein.
Diese war wie ihre Brüder ein Kind des unehelichen Sohnes von Karl Martell (Großvater Karls des Großen) namens Bernhard. Karl Martell, der 732 die Araber bei Poitiers schlug, frönte wie später sein Enkel, Karl der Große, der Liebe. Etliche Kinder mit regulären Ehefrauen und Konkubinen waren das Resultat. Auch Bernhard, welcher somit ein Onkel Karls des Großen gewesen war, reihte sich ein und zeugte Theodrada sowie ihre Brüder. Theodrada war somit eine Cousine des „großen Karl“. In dieser Eigenschaft stand ihr das Amt der Äbtissin eines Klosters zu. Ihr vorheriges Kloster Soissons übernahm ihre Tochter Imma. (7)
Die nächste Äbtissin Herfords hieß Addila. Dazu später mehr.
Da erst 1011 eine Äbtissin namens Godesdiu ein Tochterkloster für Damen des niederen Adels gründete, ist davon auszugehen, dass in Herford nur hochadelige Damen Einlass fanden. Die bedeutendsten Linien der Zeit waren die der Karolinger und nach Widukinds Taufe auch dessen Nachfahren. Äbtissin konnte nur werden, wer über die höchste Abstammung verfügte.
Die Kinder Widukinds:
Widukinds einziger Sohn Wigbert (780-834) war verheiratet mit Odrada. Sie hatten zwei Söhne:
Waltbert (stirbt nach 871) und Abbio, nach seinem Onkel benannt, der mit Wigberts unbekannter Schwester verheiratet war. Waltbert wird als Graf im Bardenau, Threcwiti und Graingau bezeugt, Namen, denen wir später wieder begegnen werden. Er heiratete Alburga, die Tochter seines Cousins Immed I. (8)
Abbo war wie Waltbert ein Enkel Widukinds und beide Brüder somit Cousins Immeds I.
Der Name Abbo ist eine friesische Kurzform von Adel- bedeutet im Althochdeutschen edel, von vornehmer Herkunft. Abbo (Wigberts Sohn) könnte mit einer Tochter des Ostdag verheiratet gewesen sein, welcher 811 zusammen mit elf anderen Grafen den Karls- und Dänenfrieden an der Eider schloss. (9)
Folgende Männer trafen sich im Auftrag Karls und des Dänenkönigs Hemming im Frühjahr 811:
Graf Walach, dieser war der Sohn Bernhards, welcher der uneheliche Sohn Karl Martells gewesen war. (Letzterer Großvater Karls und dessen Bruders Karlmann.) Wala hatte mit dem Senneschall Ludwig des Frommen Adalhart und der Äbtissin Theodrada von Soissons zwei Geschwister, die uns bereits begegnet sind. Graf Burchard, Graf Unroch, Graf Uodo, Graf Meginhard, (Begründer der Meginharde und Grafen von Hamaland, die an das spätere Königshaus Heinrichs I gebunden wurden.) Graf Bernhard, Graf Egbert, Ehemann der heiligen Ida von Herzfeld und wohl Ururgroßvater von Heinrich I von Sachsen.
Graf Theotheri, der Graf Abbo, (altersmäßig kommt hier nur der Waffengefährte Widukinds und Ehemann von dessen noch unbekannter Tochter in Frage), Graf Ostdag, möglicher Schwiegervater des Abbo von Stade und der Graf Wigman, entweder ein Hamaländer oder ein Ahnherr der späteren Billunger, Hermann und Wichmann.
Von Seiten der Dänen die Brüder Hemmings, des Königs, Hankwin und Angandeo, sowie Osfred mit dem Beinamen Turdimulo, Warstein, Suomi, das ist der heutige Name Finnlands, Urm, ein weiterer Osfrid, Heiliger Sohn, (von Oswald ?) Osfred von Sconaowe, Hebbi und Aowin. (10)
Karl der Große schickte nach dem Friedensschluss Heere aus, von denen eines an die Elbe gesandt wurde, um die Festung Hobuoki wieder herzustellen. Wir finden den Castellplatz auf dem Höhbeck, gegenüber der Burg Lenzen auf der anderen Elbseite. Das Heer setzte zu den slawischen Linonen über und verwüstete deren Land.
Diese Linonenburg Luncini spielt später 929 eine große Rolle. (11)
Karl der Große ließ also 811 die Eider als Grenze zu Dänemark festlegen und dort mehrere Grafen den Frieden beschwören. Einer davon hieß Abbio. Er kann altersmäßig Widukinds Schwiegersohn gewesen sein, was auch politisch Sinn machen würde.
Der Kauf des Klosters Wildeshausen durch Widukinds Sohn Wigbert und Enkel Waltbert wurde ebenfalls von einem Abbio bezeugt. Die Urkunde datiert um 834. Es kann sich dabei also nicht um dieselbe Person handeln, da Abbio sen., s. o. zu diesem Zeitpunkt tot gewesen sein muss.
Trotzdem ist eine nahe Verwandtschaft zu Waltbert und dessen Vater Wigbert anzunehmen, so dass wohl der zweite Sohn Wigberts, Abbio, den Kaufvertrag von Vater und Bruder bezeugte.
Waltbert und Alburga bekommen einen wissenschaftlich gesicherten Sohn, mit Namen Wicbert (bis 908), Urenkel Widukinds und Bischof von Verden, sowie Rektor von Wildeshausen. (Haus-oder Eigenkloster) (12)
Widukinds Freund und Waffengefährte Abbio, auch Alboin oder Alfric (bis 811/812), dessen Namen wir nicht nur beim Friedensschwur, sondern auch beim zweiten Enkel Widukinds und möglichem Stader Stammvater wiederfinden, war mit einer namentlich unbekannten Tochter Widukinds verheiratet.
Abbio (Alfric) und seine Frau gaben ihrem Sohn den Namen Immed. Ob dies als vermännlichte Form auf Widukinds Schwester Imhild, der Ehefrau des Haithabu Königs Harald und Schwägerin des Dänenkönigs Sigfried zurückgeht, muss spekulativ bleiben.
Immed ist jedoch mehrfach bezeugt, weil er in Urkunden bezeugt hat. Er stirbt um 829 und hinterlässt eine Tochter mit Namen Alburga, die um 812 geboren wurde. Dieser Name findet sich nicht in den Frauennamen der Haithabuer Verwandtschaft, kann jedoch von Albuin abgeleitet worden sein und somit auf ihren Großvater Abbio hinweisen.
Widukinds einziger Sohn Wigbert (770-834) und dessen Sohn Waltbert (stirbt um 872) sind ebenfalls urkundlich bezeugt. Waltbert reist u.a. 851 mit einem Diplom König Ludwigs des Deutschen nach Rom und holt für die von ihm und seinem Vater gegründete Stiftskirche in Wildeshausen die Gebeine des heiligen Alexander. (13)
Widukinds Enkel Waltbert heiratete wie bereits erwähnt Alburga, die Tochter seines Großonkels Immed I. Diese ist also die Enkelin des Freundes von Widukind , Abbio. Ihr Vater Immed I stammt aus der Verbindung Abbios mit der noch unbekannten Tochter Widukinds, ihrer Großmutter. Alburga. Ist somit Urenkelin des Widukind mütterlicherseits.
Immedinger:
Die junge Königin Mathilde, Ehefrau Heinrichs I von Sachsen soll über ihren Vater Theoderik oder Thieadrich (geb 872) eine Immedingerin gewesen sein und so, dem Namen entsprechend, über Immed von Widukind abstammen. Dazu müsste ihr Vater als Sohn entweder von einem Vater Immed aus der Linie des Ur-Opa Immed I oder aus einer Mutter dieser Abstammungsreihe hervorgegangen sein. Mathildes Oma, die 4. Äbtissin von Herford, wurde um 835-845 geboren. Sie starb um 9o8.
Thiadrich wurde als ihr Sohn um 872 geboren. Weitere Kinder von Oma Mathilde und Onkel der gleichnamigen Königin: Widukind, Immed und Reginbern. Sowohl „Omas“ Vater (Egbert?) als auch Mutter und Ehemann bleiben ein Geheimnis, das es aufzudecken gilt. (14)
Oma (geb.835 s.o.) soll auch bereits eine Immedingerin gewesen sein und das bedeutet, dass ihr Vater oder ihre Mutter ein Kind Immeds I gewesen sein muss.
Die andere Widukind Linie nach dessen Sohn Wigbert und danach Enkel Waltbert und Abbio ist insofern belegt, als dass Waltbert und seine Großnichte Alburga wieder einen Sohn mit Namen Wicbert hatten, dieser war Bischof von Verden, lebte bis 908.
Er hielt laut Stiftungsurkunde seines Vaters und Großvaters die Aufsicht über das Familienstift Wildeshausen inne. Dieses Stift wurde an einen Neffen Liudolf von Osnabrück als Rektor von Wildeshausen (gest.978), der das Stift später an Otto I veräußerte, weitergegeben. (15)
Wicbert hatte sicher Geschwister, denn ein Bruder taucht mit einem Sohn, der für eine geistliche Laufbahn bereits vor 872 vorgesehen war und die Stiftsleitung übernehmen sollte, in einem Beschwerdebrief Wicberts an den Papst Stefan auf.
Doch selbst, wenn dort ein Sohn den Namen Immed bekommen hätte, wäre dieser nur Groß-oder Urgroßneffe des Immed I gewesen. Es würde dieselbe Konstellation wie zwischen den beiden Abbios vorliegen.
Aus Vater Waltberts männlichen und weiblichen Linien müssen Liudolf von Osnabrück, dessen Mutter ebenfalls Alburga hieß, sowie die Bischöfe Wikbert von Hildesheim, Adalward von Verden und ein Adaldag, der mit dem Eb von Hamburg-Bremen Adalward bekannt war, hervorgegangen sein.
Die Stiftsleitung durfte nach der von Wicbert dem Papst Stefan vorgelegten Urkunde der Stiftsgründer nur ein Geistlicher aus der Familie übernehmen. Damit war ein sogenanntes Eigenkloster begründet worden, das in Deutschland sehr selten war, aber in Italien, wo sich Stiftsmitgründer Waltbert oft aufgehalten hatte, häufig vorkam. (16)
Widukind ließ sich 785 zusammen mit Abbio in Attigny taufen. Karl fungierte als Trauzeuge. Er hatte Widukind militärisch geschlagen und die Annahme des Christentums geschah sicher nicht aus Überzeugung, sondern zur Rettung des restlichen Sachsenvolkes.
Es ist allerdings anzunehmen, dass die späteren Erben Widukinds überzeugte Christen wurden. Ein vererbtes Eigenkloster würde die Familie Widukinds wieder in die ehemals hohe adlige Stellung vor dessen militärischer Niederlage bringen und mit dem nunmehr vorherrschenden christlichen Glauben absichern.
Dies wird auch dadurch sichtbar, dass sich Sohn Wigbert eng an den ältesten Sohn Ludwigs des Frommen, Kaiser und Nachfolger Karls, Lothar I, römischer Kaiser ab 823 anlehnte. ( gest. 855)
Nach dessen Tod wurde Wigberts Sohn Waltbert Parteigänger von Nachfolger Ludwig dem Deutschen, der ihm die Sicherheit Wildeshausens garantierte.
In die Zeit Kaiser Lothars, der den schmalen Streifen von Friesland bis Italien regierte, fielen mehrere schwere Kämpfe gegen die Wikinger, die teilweise auch in Friesland mit Gudröd 850, Sohn Harald Klaks, des Wikingerkönigs, dessen Pate Lothar 826 wurde, Grafschaften erhielten.
Der Name Lothar /Liuthar in Anlehnung an und als Ehrerbietung gegenüber dem Kaiser, wurde vom Bruder Waltberts, Abbio, über dessen Sohn Liuthar I, gefallen 880 in der Normannenschlacht bei Ebstorf und Enkel Liuthar II, gefallen 929 in Lenzen, weitergegeben. Dazu später mehr.
Die angeführten Schlachten stehen im engen Zusammenhang mit den widukindischen Nachfahren. Der Name Lothar taucht im ursprünglichen Namensgut der Familien nie auf und muss andere Ursachen gehabt haben. (17)
Alle Nachfahren des 2. Dänenkönigs Harald, der nach seinem Bruder Sigfried regierte, waren Söhne(3), Enkel(5) und Urenkel(6)von Widukinds Schwester Imhild, Haralds Gemahlin. So auch einer der beiden Gudröds, der Graf in Friesland wurde und eine Tochter namens Reinhilde bekam. Diese heiratete den Sohn Oma Mathildes Theoderik, Dietrich von Ringelheim. Und diese beiden wurden u.a. die Eltern der Königin Mathilde, Ehefrau von Sachsenkönig Heinrich I. (18)
Wenn man sich die Namensgebung der Frauen beginnend mit Kunhilde von Rügen und ihrer Mutter Gerswinde ansieht, zeigt sich der Name Gerswinde, der Großmutter Widukinds mütterlicherseits, in dessen Tochter, die 785 als Kleinkind als Geisel an den Hof Karls gegeben werden musste.
Hilde Eriksdotter war die Mutter von Geva Eysteinsdotter, der Ehefrau Widukinds. Sollte die namentlich nicht bekannte Tochter Widukinds, verheiratet mit Abbio, in dieser Tradition Mathilde oder Hilde genannt worden sein, so passt der Vorname auf Mathilde Oma, als Enkel-oder Urenkeltochter dieser beiden.
Bei Mathilde Königin ist die Großmutter- Enkeltochter Namensgebung wieder geradlinig und mit der kleinen Mathilde, der Tochter Ottos I, wurde sie erfolgreich fortgesetzt.
Bischof Liudolf von Osnabrück, der nachweislich um 967 Rektor von Wildeshausen gewesen war, musste um 900 geboren worden sein. (19)
Zu dieser Zeit gab es bereits eine weitere sehr bedeutende Linie von Widukinds Nachfahren. Dort taucht der Name Liudolf bereits als Leitname auf. (20)
Somit liegen weitere Verwandtschaftsverhältnisse nahe. Von den Söhnen Oma Mathildes war niemand Geistlicher. Deshalb hat auch niemand von denen das Rektorat über Wildeshausen besessen. Auch Thiadrichs Sohn und möglicher Bruder der Königin Mathilde Rotbert, der Geistlicher war (Eb von Trier), hatte diesen Stuhl nie inne. (21)
Mathilde Oma kann also nur Immedingerin aus der Linie von Abbio, Waffengefährte Widukinds und dessen ungenannter Tochter sein. Nur, wenn Immed I einen gleichnamigen Sohn oder eine zweite Tochter neben Alburga hatte, welche um 814 geboren worden sein können und um 835 Vater oder Mutter Oma Mathildens wurden, kann auch Thiadrich als Immedinger gelten und Mathilde Königin ebenfalls.
Was macht mehr Sinn, als dass der Name der unbekannten Tochter Widukinds und Gemahlin Alboins auch Mathilde oder zunächst nur Hilde war?
Albio oder Abbo wird in der Liste der Bilder sächsischer Herrscher als von Karl dem Großen ernannter erster Pfalzgraf von Sachsen angegeben.
Im Text steht, dass er den Glauben annahm. Damit kann nur das Christentum gemeint sein.
Hatte Immed I einen Sohn, so kann der Vater Mathilde-Omas nicht Egbert gewesen sein, es sei denn, dieser war Immeds Sohn und trug nicht dessen Namen, was allerdings der üblichen Namensgebung zu wider laufen würde.
Gab es eine zweite Tochter, ggfs. aus einer anderen Ehe, dann schon.
Mathilde Oma nannte ihre Söhne:
Thiadrich, Widukind, Reginbern und Immed.
Selbst, wenn es unter den widukindischen Geschwisterlinien weitere Immeds gegeben hat, sind nur die interessant, die von Abbio und der unbekannten Tochter Widukinds abstammen. Deren erster Sohn hieß Immed. Und auch das hatte Ursachen. Eventuell wollte man auf diese Weise Imhild, der Schwester Widukinds gedenken.
Theoderik (Dietrik) hieß auch ein Urahne Widukinds, verheiratet mit einer Slawin namens Dobrogera.
Ein weiterer Gedanke:
Aber auch Theoderich, der Große (526, Ostgotenkönig aus dem Geschlecht der Amaler, dessen Reiterstandbild Karl aus Ravenna mitbrachte) trug diesen Namen. Theoderich stand, wie andere gotische Stämme seiner Zeit im Konflikt mit dem Konzil von Nicäa. Er war Arianer, dessen Vertreter des christlichen Glaubens Arius mit anderen Bischöfen über die Glaubenslehre in Streit lag. Arius sah Christus als von Gott geschaffen und nicht wesensgleich mit Gottvater an, Bischof Athanasius beschwor das Gegenteil und gewann das Konzil. Die Wesensgleichheit von Gott Vater und Sohn ist heute Bestandteil des Glaubensbekenntnisses.
Damals wurde der Streit so intensiv ausgetragen, dass Arianer von katholischen Christen verfolgt wurden. So wurde auch das Reiterstandbild von Theoderich, der ein auf Ausgleich und Frieden bedachter König war, nach Karls Tod durch dessen Sohn Ludwig dem Frommen abgelehnt und es kam durch Ludwigs Bischöfe zum Spottgedicht, was aber nicht das Standbild an sich betraf, sondern möglicherweise die Lehre des Arius, die dahinter stand.
Für die Sachsen, die gewaltsam durch Karl ihres heidnischen Glaubens beraubt wurden, kann Theoderich der Große durchaus ein Vorbild gewesen sein. Es kommt nicht auf die Glaubenszugehörigkeit an, ob man ein großer und gerechter König wird, kann als Gedanke dahinter stecken. Zumal sich Karl als Christ römischer Ordnung um den kleinen „arianischen“ Schönheitsfehler seines Vorbildes Theoderich anscheinend gar nicht im Klaren war. Erst Sohn Ludwig der Fromme erkannte den Fauxpas.
Ich denke, die Sachsen, die sich später durch Heinrichs I Heiratspolitik bemühten, ihre Diversität in der Abstammung zu behalten und auszubauen, wollten in der Namensgebung auch ihr breites Erbe aus heidnischem und christlichen Glauben bewahren. (22)
Thiadrichs Brüder hießen Widukind, Immed (wahrscheinlich II) und Reginbern. Wenn Mathilde-Omas Mutter eine Tochter Immeds I gewesen war, kann ihr Vater Egbert, der Sohn des Reginbern, gewesen sein. Der Name Reginbern konnte aber auch über ihre Großmutter, der Ehefrau Immeds I in das Namensgut der Familie gelangt sein.
Auffällig ist, dass die Kinder Reinhildes und Dietrichs außer Mathilde keine typisch widukindischen Namen tragen. Wobei Amalrada an die Amaler, die Sippe Theoderichs denken lässt, Frideruna in die friesisch-dänische Abstammung führt und auch Bia sich nicht widukindisch annähern lässt. (23)
Immed II ist als Bruder Dietrichs (geb 872) bezeugt, Sohn von Oma Mathilde und Onkel der Königin Mathilde. Immed stiftet 941 das Kloster Ringelheim, dem Bruder Dietrich und dessen Tochter Mathilde ihren “Namen“ verdanken. Sie werden als „von Ringelheim“ bezeichnet. Immeds Tochter Imhild (Name der Schwester Widukinds!), die somit Cousine der Königin Mathilde war, leitete das Kloster Ringelheim als Äbtissin. (941, nach dessen Gründung)(24)
Danach folgte Judith als nächste Äbtissin (lebte bis 1000), eine Schwester des Bischofs Bernward von Hildesheim, Sohn des Dietrich, Pfalzgraf von Sachsen (989).
(Anmerkung: Es werden nur die Sterbedaten in Klammern angegeben, da diese in den Nekrologen bezeugt sind.)
Der Pfalzgraf von Sachsen war Sohn des Waldered (973) und der Bertha (Tochter des Burchard III von Schwaben aus der ersten Ehe mit der Immedingerin Wietrud). (Mögliche Ahnenreihe über die Linie Waltberts, also die zunächst direkt männliche Abstammungslinie Widukinds über einen nachgeborenen Sohn oder über die echte Linie zu Immed I als Vater der Alburga.
Waldered selbst war zusammen mit seinem Bruder Immed IV ein Sohn des Immed III. (954) (25)
Immed I war also der Sohn Abbios und der unbekannten Tochter Widukinds, die ich Ma (th)hilde nenne. Immeds unbekannte zweite Tochter neben Alburga wurde Mutter der Mathilde Oma (geb.835/845).
Mathilde Oma bekommt Immed II, um 874, der 941 Ringelheim stiftet.
Dessen Sohn Immed III (954)wird Vater von Immed IV und Waldered. Er fällt 954 in einer Schlacht.
Waldered (973), dessen Name an Waltbert, Sohn Wigberts und Odradas, erinnert, wird Vater des Grafen Dietrich von der Pfalz (995) und Großvater Bernwards(1022) und Judiths (1000), sowie des EB Unwan von Hamburg-Bremen. (26)
Judith stirbt 1000 und wird in der Klosterkirche zu Ringelheim beigesetzt.
Im 16. Jahrhundert wird ihr Grab wiederentdeckt, gilt aber seitdem wieder als verschollen. Ihr Bruder Bernward (960-1022) stiftete ein hölzernes Kruzifix, welches seit 1993 als Dauerleihgabe im Dommuseum Hildesheim ausgestellt wird. Bei Restaurierungsarbeiten fand man 1949/1959 im Haupt des Kreuzes einen kleinen Lederbeutel mit Pergamenten. Darauf stand: de sepulchro domini (vom Grabe des Herrn), auf der Rückseite bernwardus episcopus. Es lagen zwei kleine Steine dabei, die aus dem Heiligen Land stammen.
Von Immed IV stammt später Bischof Meinwerk von Paderborn (975-1036) ab. Erzbischof Unwan von Hamburg-Bremen (bis 1029) gehört in die Geschwisterreihe Judiths und Bernwards.
Die heute noch erhaltenen Kulturschätze Bernwards in Hildesheim stehen auf der Liste der Unesco Weltkulturerbe.
Beide Bischöfe, Meinwerk von Paderborn und Unwan von Hamburg-Bremen betonen ihre Abstammung von den Immedingern und somit von Widukind.
Unwan, EB von Hamburg –Bremen, (bis 1029) war ein Bruder der Judith und des Bernward und Urgroßneffe Immeds IV.
Meinwerk von Paderborn (975-1036) war Sohn des Immed IV. (des Bruders Waldereds) und somit Vetter des Pfalzgrafen Dietrich. (Namensgleichheit mit Mathilde- Königins Vater Dietrich).
Meinwerk war also Großonkel von Bernward, Judith und Unwan. Er hatte eine Schwester, Emma von Lesum. Seine Mutter, Adela von Hamaland, Tochter des Wichmann von Hamaland, Gründer des Stifts Elten, stritt sich mit ihrer Schwester Luitgard um das Erbe und vergiftete diese später. Sie heiratete erneut, war an der Ermordung ihres eigenen Sohnes Dietmar und des Wichmann von Vreden beteiligt. Sie wurde wie ihr Mann wegen Mordes verurteilt. Ihr Leichnam wurde von aufgebrachten Bürgern in den Rhein geworfen. (Legende) Für uns eigentlich unwichtig, erhöht aber den Gruseleffekt. (27)
Über die Äbtissinnen des Klosters Ringelheim, von Immed II, Sohn der Mathilde Oma, gegründet und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zur Familie Widukinds sowie dessen ehemalige Verbündete in Engern, erfahren wir später.
Zurück zu Herford. Das Kloster Herford wird also von Tetta von Soissons, der unehelichen Cousine Karls (des Großen) mithilfe deren Brüder, der Corveyer Äbte Wala und Adalbert, übernommen (28) Es erhält den Beinamen Notre Dame de Soissons, was ins Frankenreich führt und eine enge Verbindung zur Familie Karls vermuten lässt. Notre Dame de Soissons wird von Tettas Tochter Imma weitergeführt. (28)
Über ihre Abstammung und ihrem Vetter Karl (den Großen) wird im Anschluss geforscht. Auf Tetta (-838), die aufgrund ihrer hohen Geburt Anspruch auf die Stellung einer Äbtissin hatte, folgte die Addila (vor 844- nach 853), über die ich ebenfalls in einem gesonderten Abschnitt recherchiere. (29)
Ihre Nichte Haduwich folgte von 858-888. (30)
Danach übernahm Mathilde (Oma) von 908-911. Sie erzog Mathilde Königin, die 908 vierzehnjährig mit Heinrich I vermählt wurde. (31)
In den Jahren von 919-924 wurde das Kloster von den Ungarn zerstört. Die Äbtissin Imma (32) baute es 927 wieder auf. Sicherlich mit der Hilfe Heinrichs I.
Immas Vorgängerin, die 926 starb, hieß Hatheburg. Dies wird noch später einen bedeutsamen Platz in meinen Ausführungen einnehmen.
Auf Imma folgen die gleichnamige Äbtissin Imma, eine Billungerin (973-998), welche mit der Herforder Marienerscheinung in Zusammenhang gebracht wird und die Äbtissin Godesdiu von 1002-1040. Sie erbaut auf dem Stiftsberg ein Tochterstift für einfache adlige Damen. (33)
Die Tatsache, dass erst nach 1000 adlige Damen aus niederen Adelsfamilien Aufnahme fanden, liegt nahe, dass das von Waltger gegründete und von Tetta von Soissons bis 838 geführte Kloster nur Damen der höchsten Familien vorbehalten war. Das gilt natürlich insbesondere für die Äbtissin.
Quellen
(3) https://www.geschichtsquellen.de/werk/3349
(4) https://de.wikipedia.org/wiki/Angrivarier
http://www.45-minuten-stunde.de/images/stories/45-minutenstunde/kirche_enger/Kirchenfuehrer2001_ueberarbeitet.pdf
G_das_kirchspiel_enger.pdf
Enger – Wikipedia
(5) Mathilde (Quedlinburg) – Wikipedia
(6) https://wiki.genealogy.net/Frauenstift_Herford
(7) https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Martell
http://www.nhv-ahnenforschung.de/Bernhard/LippezurBernhardVIIKekLV/html/p001562.htm
https://blum.familyds.com/family.php?famid=F13052&ged=Habsburger
http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/_voelkerwanderung/b/bernhard_karolinger_787/bernhard_787.html
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienT/Theodrada.html
http://www.manfred-hiebl.de/mittelalter-genealogie/_voelkerwanderung/t/theodrada_aebtissin_846/theodrada_aebtissin_846.html
(8) https://de.wikipedia.org/wiki/Godesdiu
(9) abbio_graf_785
Wigbert von Verden – Wikipedia
http://www.manfred-hiebl.de/genealogiemittelalter/immedinger_widukind_sippe/waltbert_graf_im_graingau_ um_890/waltbert_graf_im_graingau_um_890.html
Amt Wildeshausen (historisch) – GenWiki
Alexanderkirche (Wildeshausen) – Wikipedia
Albion (Heerführer) – Wikipedia
Bardengau – Wikipedia
Hochstift und Herzogtum Verden – Wikipedia
Ahnentafel von Richard I. von England https://de.wikipedia.org/wiki/Ostfriesischer_VornameAhnentafel von Richard I. von England https://de.wikipedia.org/wiki/Ostfriesischer_Vorname
(10) https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nsfurth
Wala (Karolinger) – Wikipedia
(11) http://www.kmrz.de/lh_archivbaende/texte/texte_1889/lh_1889_08.ht m https://www.komoot.de/highlight/256313
https://de.wikipedia.org/wiki/Linonen
(12,13) s. 9
(14) Dietrich of Ringelheim - Wikipedia
(15) Die politische Bedeutung der Elbslawen im Hinblick auf die Herrschaftsveränderungen im ostfränkischen Reich und in Sachsen von 887 – 936
(16) https://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/z/zsn2a023606.pdf
(17) karl_1_der_grosse_frankenkoenig_+_814
NLA ST Rep. 2 Nr. 2 - König Ludwig der Deutsche n... - Arcinsys Detailseite
(18) DeWiki > Harald Klak König von Haithabu – Wikipedia
(19) http://www.manfred-hiebl.de/genealogiemittelalter/immedinger_widukind_sippe/liudolf_bischof_von_osnabrueck_978/liudolf_ bischof_von_osnabrueck_+_978.html
(20) https://de.wikipedia.org/wiki/Liudolf_(Sachsen)
(21) https://de.wikipedia.org/wiki/Ruotbert_von_Trier
(22) Thuerlemann_Bedeutung_1977.pdf
Reichenauer Verbrüderungsbuch - Thiadrich – Wikipedia
Die Bedeutung der Aachener Theoderich-Statue für Karl den Grossen (801) und bei Walahfrid Strabo (829): Materialien zu einer Semiotik visueller Objekte im frühen Mittelalter
(23) https://de.wikipedia.org/wiki/Amaler
https://de.wikipedia.org/wiki/Frederuna
https://www.kinderinfo.de/vornamen/maedchen/frederuna/
https://www.vorname.com/name,Bia.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Frederuna
(24) https://de.wikipedia.org/wiki/Immedinger
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Ringelheim
(25) St. Abdon und Sennen (Ringelheim) – Wikipedia
Bernward von Hildesheim – Wikipedia
Meinwerk – Wikipedia
Waldered IMMEDINGER-Graf
Immed IV von Sachsen Graf von West-Sachsen – Wikidata
(26) http://www.manfred-hiebl.de/genealogiemittelalter/immedinger_widukind_sippe/immed_3_graf_953/immed_3_graf_953.html
(27) https://de.wikipedia.org/wiki/Adela_von_Hamaland
(28,29-33) https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1557825
https://de.wikipedia.org/wiki/Imma_I.
Grundlagenwissen zu Karl (dem Großen) und dessen Bruder Karlmann, sowie mögliche familiäre Zusammenhänge zwischen den Karolingern und den Erben des Widukind.
Karl, mit dem späteren Beinamen „der Große“ wurde zwischen 742 und 747 geboren, war König der Franken von 768-814, wurde 800 römischer Kaiser und 774 König der Langobarden. Er war der Sohn Pippins III und Enkel Karl Martells, welcher 732 die Araber bei Poitiers schlug. (1)
Karl Martell hatte mehrere Kinder mit Konkubinen, darunter Bernhard, welcher Vater der Herforder Äbtissin Tetta und der Corveyer Äbte Adalhard und Wala wurde. (2) (3)
Karl wurde bereits 754 zusammen mit seinem Bruder Karlmann zum König gesalbt. Karlmann starb 771 unter mysteriösen Umständen, so dass Karl das gesamte Erbe des Bruders übernahm. Karlmann war wahrscheinlich mit einer Tochter des Langobardenkönigs Desiderius verheiratet und hatte mit ihr zwei Söhne. Diese tauchen später nie wieder auf. Auf Druck Bertas, der Mutter Karls, heiratete dieser ebenfalls eine Tochter des Langobardenkönigs, obwohl er bereits relativ glücklich verheiratet war und seine bisherige Frau dafür verstoßen musste. Der Papst Stephan III war gegen diese Heirat. Zwischen Karlmann und Karl gab es viel Streit. Karlmann starb 771 sehr plötzlich. Er war ein junger und gesunder Mann von etwa 20 Jahren. Seine Frau Gerperga flüchtete nach seinem Tod mit den beiden Söhnen, von denen einer den Namen seines Großvaters Pippin trug, zusammen mit ihrer Schwägerin zu Desiderius. Diese Schwägerin war die Frau, die Karl auf Wunsch seiner Mutter heiraten musste. Sie wurde nach Karlmanns Tod von Karl wieder verstoßen.
Es ist anzunehmen, dass Gerperga, deren Name später im Namensgut der Karolinger, Sachsen und Widukindnachfahren immer wieder auftaucht, noch Eltern hatte. Eine Frau geht nach dem Tode ihres Mannes in der Regel zu ihrem Vater zurück. Bei ihrer Schwägerin ist dies bezeugt. Daher liegt es nahe, dass auch Gerperga eine Tochter des Desiderius war. Die Annahme einer engen Verwandtschaft wird auch dadurch unterstrichen, dass sich Desiderius als König der Langobarden für das Erbe des kleinen Pippin einsetzte. Warum sollte sich ein Fremder sonst um den kleinen Sohn Karlmanns kümmern?
Es ist möglich, dass Gerperga, als sie am Hof ihres möglichen Vaters Desiderius eintraf, wieder schwanger war. Sie gebar eine Tochter, die auf den Namen Ida getauft wurde und später in enger verwandtschaftlicher Beziehung zu Karl stehen wird. Wir werden sie als Heilige Ida von Herzfeld in einem anderen Zusammenhang wiedertreffen. Gerperga und ihre Söhne bleiben verschollen, nachdem Karl Desiderius und dessen Familie kurz nach der Flucht im Kampf 774 besiegte. Karl wurde auf diese Weise König der Langobarden.
Da Karlmann als zwanzigjähriger junger Mann nach kurzer Krankheit starb und Gerperga mit den Söhnen zu Desiderius floh, liegt es nahe, dass Karlmann nicht eines natürlichen Todes gestorben sein kann. Eine Flucht hätte sich ansonsten erübrigt und da Karl bereits legitime Söhne hatte, hätte es um die Nachfolge kaum Streit geben können.
Es stellen sich viele Fragen. Karl hatte nach dem Tod seines Bruders alles, was er wollte. Er konnte das Land allein regieren. Seine Neffen waren noch zu klein um Ansprüche auf das Erbe ihres Vaters geltend machen zu können.
Wo blieben sie? War Karl, von dem wir wissen, dass er den Frauen sehr zugeneigt war und im Laufe seines Lebens achtzehn Kinder zeugte, nicht nur ein Weiberheld, sondern auch ein Kindermörder? Wollte er bei Ida alles gut machen, was er an ihren Brüdern verbrochen hatte? Ob Karl selbst am Tod seines Bruders beteiligt war oder seine Vasallen ihm einen Gefallen getan haben, muss offen bleiben.
Ida, deren Verwandtschaft zu Karl nur über dessen Bruder Karlmann möglich sein kann, wurde mit einem Gefolgsmann Karls, dem Edlen Grafen Egbert (Sohn des Reginhart) verheiratet. Auch ihre gleichnamige Tochter Ida wird mit dem Sohn eines Gefolgsmannes, dem Esikonen und Sohn Hildebolds (Hiddi) –davon später mehr- Asik verheiratet. Diese Ida wird Mutter der Haduwich, welche nach dem Tod ihres Mannes Amelung die 3. Äbtissin Herfords werden wird. Vorgängerin war ihre Tante Addila, die Schwester Idas der Jüngeren. Auf Haduwich folgte Mathilde Oma. Können das alles Zufälle sein?
Zurück zu Karlmann. Giftmorde waren seit jeher nichts Besonderes. Ein prominentes Beispiel war Kaiser Claudius, der wohl von seiner Frau Agrippina vergiftet wurde und so den Weg für deren berühmten Sohn Nero freimachte.
Karlmann musste 771 bereits seinen Tod geahnt haben, denn er machte dem Kloster St. Denis Schenkungen.
Bei alledem fragt man sich auch, wo war Oma Berta? Karl verbot ihr, sich weiter in die politischen Angelegenheiten einzumischen. Aber sie war immerhin die Oma der Karlmann Kinder.
Karl wird später die kleine Gersvinde (Tochter Widukinds) zur Konkubine nehmen. Gersvinde wird ihm eine Tochter mit Namen Adaltrude schenken. Diese ist somit nachweislich die Enkeltochter Widukinds. Auch ohne Eheschließung wird Karl auf diese Weise zu einer Art Schwiegersohn des einst verhassten Sachsenherzogs, dessen Taufpate Karl wurde. (776 in Attigny, wo neben Widukind auch sein Freund und wahrscheinlicher Ehemann von Tochter Mat(hilde) Abbio gehörte. Die beiden wurden Eltern von Immed I und sind damit die Vorfahren der Immedinger, deren Nachfahrin Königin Mathilde als Ehefrau Heinrichs I deutsche Geschichte schrieb.)
(4 ff)
Quellen
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Martell
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Wala_(Karolinger)
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Gerperga
Im Bett mit Karl dem Großen.pdf
adaltrud_tochter_karls_des_grossen_+_nach_800
Deutsche Biographie - Karlmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekbertiner
Annales regni Francorum – Wikipedia
Kaiser Claudius letzter Seufzer | PZ – Pharmazeutische Zeitung
Karl der Große in Geschichte | Schülerlexikon | Lernhelfer
Ida von Herzfeld
Über die Abstammung der Ida von Herzfeld ( 770 /775 -825) gibt es zwei Vermutungen. Dass ihre Mutter Theodrada von Soissons gewesen ist (Tochter Bernhards, des nichtehelichen Sohnes von Karl Martell) die wir als erste Äbtissin des Klosters Herford bereits kennengelernt haben, erscheint unwahrscheinlich. Theodrada selbst wurde erst um 776 geboren. Ihre Tochter Imma folgte ihr 846 als Äbtissin von Soissons. (1)
Ida stand in enger verwandtschaftlicher Beziehung zu Karl. Sie wurde mit einem Karlstreuen Vasallen namens Egbert verheiratet, ging mit ihm 786 auf seinen Besitz in Westfalen (Osnabrück) Auch ihre gleichnamige Tochter wurde mit einem Karlstreuen verheiratet, darüber später mehr. Es könnte sein, dass man so Idas Loyalität zu Karl sicherstellen wollte. Sollte sie tatsächlich die posthum geborene Tochter Karlmanns sein, wofür einiges spricht, hätte sie womöglich Erbansprüche hinsichtlich dessen Vermögens. Ihre beiden Brüder tauchen nie mehr in den Annalen auf und es liegt nahe, dass sie umgebracht wurden. Ihre Mutter Gerperga, die sich nach dem frühen und überraschenden Tod ihres Mannes Karlmann zu ihrem Vater Desiderius, König der Langobarden, geflüchtet hatte, brachte sie noch vor oder während des Kampfes und der Niederlage des Desiderius gegen Karl zur Welt. Als Mädchen verschonte man sie möglicherweise. Ida wird später durch ihre Frömmigkeit und Mildtätigkeit den Beinamen die Heilige erhalten. Ahnte sie, dass ihr Onkel den Tod ihrer Eltern und Brüder initiiert hatte? Musste sie deshalb Egbert heiraten, damit die Wahrheit über ihren „großen“ Onkel Karl nicht ans Licht kam? Flüchtete sie sich deshalb zu Gott um für die Schuld ihrer Familie zu beten? (2)(3)
Während ihrer Reise zu Egberts Gütern erhielt Ida im Traum eine Vision. Sie baute in Herzfeld im Münsterland eine Kirche und stellte sich vor die Sachsen, die, wie wir wissen (Widukind) mit den Franken im Krieg standen. Egbert starb 811, im Jahr des Friedensschlusses mit den Dänen an der Eider, an der ein Egbert teilgenommen hatte. Ida baute über der Grablege ihres Mannes einen Portikus, in dem sie wohnte. Sie beschenkte die Armen, widmete sich dem Gebet. Ihr Sarkophag und Reliquien werden in der Grabkrypta der seit 2011 bezeichneten päpstlichen Wallfahrtsbasilika in Herzfeld aufbewahrt. Es finden heute Wallfahrten dorthin statt.
Eine ihrer Töchter, die gleichnamige Ida, wurde mit Asig, einem Esikonen verheiratet, der im Hessengau ansässig war.
Asigs Vater hieß Hildebold, genannt Hiddi. Es ist belegt, dass ein Teil der ehemaligen Sippe und Anhänger Widukinds von den Angrivariern ausgestoßen wurden, weil sie mit dem Feind Karl paktierten und nach der verlorenen Schlacht in Engern zu ihm überliefen. Sie wurden von Karl bei Wolfsanger (Stadteil von Kassel) im Hessengau (fränkisches Gebiet) neu angesiedelt. Einer dieser Grafen war Hildebold. Dort treffen weitere Flüchtlinge ein. Hiddi rodet Land, das Karl ihm, seinem Sohn Asig und dem Billunger Amelung I sowie dessen Sohn Bennid überlässt. (Heute Benterode, Escherode)
Asig wird Ida heiraten, die über ihre Mutter Ida von Herzfeld eine Großnichte Karls ist. Später wird Asigs und Idas Tochter Haduwich den Sohn Bennids, Amelung II heiraten und nach dessen Tod die dritte Äbtissin im Kloster Herford werden. (4,5) Egbert, Hiddi und Asig waren treue Vasallen Karls. Die beiden letzteren stehen für die Asig Diplome, 813 einige der letzten Diplome von Karl vor dessen Tod von diesem ausgestellt.
Hildebold war mit Schwanhilde von Engern verheiratet. Aus dieser Ehe stammte Asig, der Stammvater der Esikonen und Ehemann Idas der Jüngeren. Schwanhilde war die Schwester des Berno von Engern. Vater der beiden war Brun I von Engern, der Heerführer Widukinds. Möglicherweise über dessen Vater Warnechin von Engern mit diesem verwandt oder verschwägert. BrunI starb um 776. Sein Sohn Berno war verheiratet mit Hasela, der Tochter Widukinds. Sie hatten einen Sohn mit Namen Brun II. Demnach war Hiddi als Ehemann von Bernos Schwester dessen Schwager und musste wegen seiner Karlstreue nach der verlorenen Schlacht als Verräter gelten. Widukind war zu der Zeit (775) zu seinen Schwagern Siegfried und Harald nach Haithabu geflüchtet. Die Familie Hiddis konnte nicht in Enger bleiben. (s. heute Hiddenhausen!) Sein Vater Luitolf wurde Mönch und starb 785 im Kloster Fulda. Wahrscheinlich wurde er von Karl gezwungen ins Kloster zu gehen. (6, 7,8, 9)
Der Name Liudolf wird uns gleich wieder begegnen. Hiddis Name taucht bei seinen Erben nie mehr auf. Außer: Im heutigen Hiddenhausen, welches einige Kilometer entfernt von Engern liegt, in dessen Kirche noch heute der Epitaph mit dem Bild Widukinds aufbewahrt wird und das im Widukindmuseum Aufschluss über die Geschichte des Sachsenherzogs gibt.
Zusammengefasst:
Ida von Herzfeld, die wahrscheinliche Großnichte Karls und posthum geborene Tochter dessen Bruders Karlmann, nahm also die Sachsen, die gegen ihren Onkel und die Franken einen 32 jährigen Krieg führten, in Schutz. Ihre Tochter Ida heiratete mit Asig (dessen Mutter war Schwanhilde) den Neffen des Berno von Engern. Idas angeheiratete Tante Gisla oder Hasela war die Tochter Widukinds.
Weitere Namen aus dem ehemaligen Land Engern tauchen im Zusammenhang mit der Umsiedlung nach Kaufungen auf:
Amelung I, gehörte einem sächsisch-thüringischen Adelsgeschlecht an. Seine Brüder hießen Billung, Rudrat, Bennid und Wicmann. Als Söhne und Nachfahren tauchen Amelung II, vh. mit Haduwich, Enkelin Idas von Herzfeld und 3. Äbtissin Herfords auf.
Weitere Namen: Amelung III, BennidII, Alberat, Hemma, Hrodrah, Folculf, Wentilpurg, Retum, Brunning, Asarich, Amelung, Folchard, Hiltiburg, (diese waren Gründer des Klosters Möllenbeck), Folcheri (beneficium in pagis Grainga et Trecwithi), Delheri etc.
Die Billunger Grafen, die erst um 938 mit Hermann von Billung als princeps militae Ottos I fassbar werden, gehen zurück auf Namen wie Amelung, Wichmann, Bennid (Bernhard), Hermann, Billunc und andere. Während der Regierungszeit Karls gab es Streit innerhalb einer mächtigen Sippe im Norden, die sich in der Parteinahme für Karl unterschied.
Ein Zweig wurde aus dem Stammgebiet vertrieben und erhielt von Karl neues Territorium.
Auch der Vater Asigs I und Schwiegervater Idas, der Jüngeren, Hildebold, Graf im Hessengau, stammte wahrscheinlich aus einer dieser Sippen. (Folcmar, pago Hessi). Folcwart comes, stirbt wie drei Bardos und ein Wicmann 880 in der Dänenschlacht.
Daneben versippten sich die Meginharde, Hamaländer und eben diese Bardos, die ihrerseits wieder in die großen Familien Liudolfs von Sachsen und in die der Nachfahren Karls einheirateten. (Heute noch sichtbar an Hamburg und Bardowik) Leider sind die Linien fast nur im Mannesstamm bekannt, von den Töchtern wissen wir wenig.
Hermann Billungs Bruder Wichmann (900-944), vh. mit Bia, einer Schwester Mathildes und seine Söhne werden in der Auseinandersetzung mit Kaiser Otto I noch eine Rolle spielen.
Heerführer Bernhard von Borghorst, der als militärischen Erfolg den Sieg in Lenzen 929 verbuchen konnte und 935 starb, war möglicherweise der Vater der Brüder Wichmann und Herrmann, wozu mit Amelung noch ein Bischof gehörte.
Bernhards Frau Bertha stiftete als Witwe ein Kloster, welches heute zu Steinfurt gehört. (10 –11) Zu Bernhard später mehr.
Rückblende: Wir erinnern uns an das Kloster Ringelheim, das von Immed II von Ringelheim gestiftet wurde und Namensgeber für Dietrich von Ringelheim sowie einer seiner Töchter, nämlich Mathilde, der zweiten Frau Heinrichs von Sachsen, des Kriegsführers 929 in Lenzen, wurde. Zu Heinrichs Abstammung kommen wir gleich.
Ringelheim als Hauskloster Dietrichs von Ringelheim, von dessen Bruder Immed II gestiftet, ist sicher bezeugt. Immed II ist über seine Mutter Mathilde (Oma) ein Immedinger. Großvater ist Immed I, Sohn des Abbio und der unbekannten Tochter Widukinds, für mich Mathilde oder Hilde.
Imma, die Tochter des Stiftgründers und Judith, Ururenkelin des Stiftgründers über dessen Sohn Immed III und Enkel Waldered (Waltbert), als Äbtissinnen in der Nachfolge Widukinds sind ebenfalls verständlich.
Den Namen Judith finden wir bei der Ehefrau Heinrichs von Stade, aus dem Hause der Konradiner als Großmutter Thietmar von Merseburgs. Heinrich von Stade und seine Familie (Liuthar II starb in der Schlacht bei Lenzen) betrachten wir später. (12)
Letzte Äbtissin des ehemaligen Frauenklosters Ringelheim aus der Linie Widukinds (ImmedI-IV)wird Eilika, aus dem Hause der Esikonen. Danach wird das Kloster Benedektinerkloster der Männer hlawitschka
Die Esikonen treffen wir zunächst mit Asig I und seiner Ehefrau Ida, der Jüngeren, Tochter des Grafen Egbert und der Ida von Herzfeld zwischen 785/824 und Asigs Vater Hiddi (Hildebold) 813. Esikonen – Wikipedia
Kinder der Ida und des Asig werden Cobbo, der jüngere und Hedwig, 3. Äbtissin von Herford, Vorgängerin von Mathilde –Oma als Äbtissin.
Die spätere Familie trägt die Namen Grafen von Reinhausen und Formbach-Winzenburg.
Die Vornamen Heinrich, Hermann, Mathilde, Udo, sind auffällig.
Auch Heinrich und Hermann von Lüchow tauchen um 1188/1232 auf. Die Eigentümer des Klosterbergs zu Reinhausen - Esikonen – Wikipedia
Man kann also aus den Namen der Äbtissinnen und ihrer Abstammung Rückschlüsse zu den Vorfahren ziehen und die Ahnenreihe rückwärts feststellen.
Quellen
2,3 https://de.wikipedia.org/wiki/Ida_von_Herzfeld
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Hiddi_(Hildebold)
(6) http://www.thepeerage.com/p67238.htm#i672373
(7))http://www.geschichte-online.info/04_04_Sachsen.pdf
(8) https://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a137136.pdf
(9) https://wiederhold.org/individual.php?pid=I44290&ged=tree1
(10,11) mmainleite2003-3.PMD - 2003-3.pdf
Die Kinder der Ida von Herzfeld
Der fränkische Graf Egbert (756-811) errichtete im Auftrag Karls (des Großen) nördlich der Elbe den Ort Esesfeld, das heutige Itzehoe. Ekbert wurde Stammvater der Ekbertiner (die Schreibweise ist unterschiedlich). Der Familie wird eine spätere enge Verwandtschaft zu den Liudolfingern nachgesagt.
Egberts Besitz befindet sich südlich von Westfalen, zwischen Rhein und Weser. Er ist verheiratet mit Ida von Herzfeld, einer fränkischen Adligen. (Vitae Idae von 980)
In Itzehoe zeugt noch heute der Graf Egbert-Ring vom einstigen Stadtgründer.
Ida und Egbert haben folgende Kinder:
Cobbo, der Ältere (Diplomat und Graf in Westfalen bis 850, Parteigänger Ludwigs des Deutschen, der ein Sohn Ludwigs des Frommen und somit Enkel Karls des Großen war)
Warin , Abt von Corvey
Ida, die Jüngere, bereits erwähnt als Ehefrau des Asig und Schwiegertochter des Hildebold (vh. mit Schwanhilde, Schwägerin von Gisela, Tochter des Widukind)
Addila, die nach dem Tod ihres Mannes Brunicho Äbtissin von Herford wurde.
Brunichos Eltern waren keine geringeren als Berno von Engern (Sohn des Heerführers Widukinds Brun I) und Gisela, der Tochter Widukinds.
Addila und ihr Mann Brun II hatten einen Sohn mit Namen Liudolf. Hierbei kann es sich bei der Namensgebung um die Ehrung des 785 ins Kloster Fulda eingetretenen Liutolf, Vater des Verräters Hiddi handeln. Hiddis Name taucht nie wieder auf. Der Name Liudolf findet sich auch bei einem Bruder Cobbos, des Älteren, also Sohnes der Ida und des Egbert wieder. Liudolf und Cobbo waren Parteigänger Ludwigs des Deutschen, der sich mit seinem Bruder Lothar in der Nachfolge Ludwigs des Frommen um die Kaiserkrone stritt. (2)
Liudolf, Cobbos I Bruder, war mit der Schwester des Grafen Bardo (s. Bardowik) Roswitha von Liesborn verheiratet. (3)
(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Ekbert_(Sachsen)
(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Ekbertiner
(3) https://www.wikiwand.com/de/Roswitha_von_Liesborn
Die Nachfahren Adilas und Bruns II
Neben Wigbert, Gersvinde und (Ma)hilde hatten Widukind und seine Frau Geva noch eine weitere Tochter, mit Namen Gisla. Sie heiratete den Sohn seines Heerführers Brun I, dessen Name Berno von Engern war. Ihr Sohn Brunicho II wurde Ehemann von Adila, der Tochter der heiligen Ida von Herzfeld und des edlen Grafen Ekbert. (1)
Der Sohn von Brunicho II und Adila wurde auf den Namen Luidolf getauft. Seine Lebensdaten: (806- 866) (2)
Luidolfs Besitz reichte von Ostfalen über Engern bis Westfalen (Draingau), Seesen, Gandersheim, Pöhlde/ Eichsfeld, Werla/Lutter, Bardengau bei Lüneburg (vgl Graf Bardo, Parteigänger Ludwigs des Deutschen zusammen mit Cobbo, dem Älteren (Sohn Ekberts und Idas) und dessen Bruder Liudolf, vh. mit Roswitha von Liesgau, einer Schwester des Grafen Bardo. Dessen Familie nahm am 2.2. 880 an der Normannenschlacht in Ebstorf teil, in der neben dem ältesten Sohn Luidolfs, Brun, auch Lothar I von Stade, Vater des 929 in Lenzen gefallenen Luithar II von Stade, fielen)
Weiterer Besitz Luidolfs, der ebenfalls im Dienst Ludwig des Deutschen stand und gegen die Dänen das sächsische Heer befehligte, lag bei Kalbe/Magdeburg/Barby. Liudolf wurde als Graf/ Herzog von Ostfalen bezeichnet. Er heiratete Oda, die Tochter des fränkischen Adeligen Billunc und dessen Frau Aeda. Billunc finden wir im Ahnengut, der wie Hiddi von Engern nach Kaufungen vertriebenen Familie Amelungs I. (Urkunden Karls 811) Dessen Brüder hießen Billunc, Rudrat, Wicmann, Bennid. Aeda führt in die Familie der Konradiner, die auch den Namen Otto weitergaben. Amelung I (s. heute Amelinghausen) und sein Sohn Bennid (Benterode) erhielten wie Hildebold Land. Die o.a. Namen finden sich später in der Billunger Familie wieder, die unter Wichmann und seinem Bruder Hermann (ab 900) unter Otto I richtig fassbar werden.
Bennids Sohn Amelung II wird Haduwich heiraten, die Enkeltochter Ekberts und Idas, die Tochter Idas, der Jüngeren und Asiks, des Sohnes von Hildebold und Schwanhilde. Haduwich wird nach ihrer Tante Adila Äbtissin in Herford.
Luidolfs Großvater und Vater hatten vor 824 bereits eine Eigenkirche in Brunshausen. Oda, (geb. wie Liudolf um 805, verstorben mit 107 Jahren um 912) und Liudolf gründen dort um 850 ein Frauenkloster, das später nach Gandersheim zieht. Dass Adila nach dem Tod ihres Mannes Brunicho Äbtissin in Herford wurde, ist in der Äbtissinnenliste belegt. (4)
Einer ihrer Brüder (Eltern Ekbert und Ida) hieß ebenfalls Liudolf. (s. Cobbo und Roswitha von Liesgau, deren Bruder Bardo) Auch Hiddis Vater hieß Liutolf. Hiddis Sohn Asik/Esiko heiratete Adilas Schwester, Ida, die Jüngere. Ekbertiner, frühe Billunger und die Liudolfinger (nach Liudolf, Herzog von Ostfalen) waren miteinander verschwägert. Es finden sich Vorfahren aus der Linie Widukinds. (s.a. Stade) Liudolfs Vater Brun II und sein Großvater Berno von Engern (Sohn Bruns I) passen namensmäßig zu Brunshausen, so dass eine Abstammung Liudolfs von Adila (Ekbertiner) und Brun II (Widukind) möglich ist.
Ein weiteres Indiz ist der Vorwurf des Mönches Uffing, sowohl Liudolf als auch sein Sohn Otto, der Erlauchte, haben sich nicht um das Grab auf ihrem Besitz Herzberg gekümmert. Oda und Liudolf hatten viele Kinder. Ein Sohn war früh verstorben und auf dem Hof der Ida von Herzfeld, welcher im Besitz Liudolfs war, bestattet worden. Aber auch das Grab seiner wahrscheinlichen Großmutter Ida befindet sich dort. Auch wenn es keine klaren Abstammungsurkunden gibt, fügen sich kleine Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammen.
Oda und Liudolf begeben sich 845/846 nach Rom zu Papst Sergius II und bitten um Altersdispens für ihre Tochter Hathemod, damit diese bereits zwölfjährig im Jahre 852 Äbtissin ihres gestifteten Klosters Gandersheim werden darf. Der Papst genehmigt dies und gibt ihnen Reliquien heiliger Päpste mit. (5)
Die Kinder Odas und Liudolfs sind:
Brun (830/ 840, die Geburtsdaten sind nicht festgelegt, jedoch wurde Oda um 805 geboren, kann also um 830 gut 25 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte auch mehrere Totgeburten, bzw. früh verstorbene Kinder, wie den kleinen Sohn, der auf Gut Herzberg bestattet wurde. Ihre Kinder datieren bis 850, was biologisch möglich sein kann. Um 866 stirbt Liudolf und Oda wäre mit 65 Jahren auch zu alt für eine Schwangerschaft gewesen. Sie stirbt aber erst um 912 und soll die Geburt ihres Urenkels Otto I noch miterlebt haben. )
Brun war als Nachfolger für seinen Vater vorgesehen gewesen, fällt aber am 02.02.880 in Ebstorf in der Normannenschlacht. Dort fallen auch drei Bardos, sowie der Mann seiner Schwester Enda (bis 879) mit Namen Lothar I von Stade. (6) In der folgenden Schlacht bei Lenzen 929 fällt auch der Sohn der beiden, Liuthar II von Stade. Wenn man davon ausgeht, dass Enda bei der Geburt ihres Sohnes starb war dieser 929 ca. 50 Jahre alt. (7) Die Familie der Stades wird mit dem Sohn Liuthars II, Heinrich I von Stade sehr eng mit der Liudolfinger Familie verbunden werden. Die Familiengeschichte der Stades und der Walbecks (Chronist Bischof Thietmar von Merseburg) folgt im Anschluss an die der Liudolfinger.
Da Brun in der Normannenschlacht, in der die Widukindnachfahren auf sächsischer und dänischer Seite (über Imhild, des Widukinds Schwester) gegeneinander antraten, fiel, musste Liudolf die Erbfolge in seinem Haus neu regeln.
Es folgte der zweite Sohn Otto, der Erlauchte. Da der Name im Gegensatz zu Brun im Namensgut der Vorfahren Liudolfs nicht vorkommt, kann er aus der Familie seiner Frau Oda stammen. Deren Mutter hieß Aeda. Auch passen Oda und Odo: Otto gut zueinander.
Otto der Erlauchte wird als Herzog von Sachsen und Vater Heinrichs I eine bedeutende Rolle spielen.
Ein weiterer Sohn mit Namen Thankmar starb früh. Diesen Namen werden wir bei den Nachkommen Heinrichs I in tragischer Weise wiederfinden. (8)
Schwestern:
Enda, wie erwähnt. Sie wird eine Art Stammmutter für den Chronisten der Stader Familie werden: Bischof Thietmar von Merseburg. Thietmar wird ihr Ururgroßenkel sein.
Hathumod, wird zwölfjährig mit Dispens des Papstes Sergius II Äbtissin von Gandersheim, Kloster gegründet erst in Brunshausen durch ihren Vater Liudolf und ihre Mutter Oda. (Hathumods Name wird sich im Namensgut der Stader Familie bei ihrer Urenkelin wiederfinden, die ebenfalls bereits zwölfjährig Äbtissin von Heeslingen wird.)
2. Äbtissin Gandersheims wird Gerberga ( erinnert an die mutmaßliche Mutter der Ida von Herzfeld, der Tochter des Desiderius und Ehefrau Karlmanns)
Und 3. Äbtissin wird Christina. (8)
Eine weitere Schwester mit Namen Liutgard heiratete den Sohn Ludwigs des Deutschen, Ludwig III, den Jüngeren.
(Somit einen Urenkel Karls)
Ludwig war König des Ostfrankenreichs. Der Sohn Ludwig aus dieser Ehe starb früh und die Tochter Hildegard wurde wegen Verschwörung ins Kloster verbannt. (9)
https://mineralien.lima-https://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/udonen_grafen_von_stade/lothar_1_graf_von_stade_880/lothar_1_graf_von_stade_Ihm+_880.htmlIcity.de/ahnentafel/17892.htmhBttpBruns://wiederhold.org/individual.php?pid=I44290&gedhttps://wiederhold.org/individual.php(1(1reehttps://wiederhold.org/individual.php?pid=I44290&ged=tree1 1 =tree1
(1)https://wiederhold.org/individual.php?pid=I44290&ged=tree1
(2) https://mineralien.lima-city.de/ahnentafel/17892.htm
(4) https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1557825#.C3.84btissinnen
(5) https://mineralien.lima-city.de/ahnentafel/17892.htm
(8) https://www.deutsche-biographie.de/sfz53551.html
(9) https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_III._(Ostfrankenreich)
Otto der Erlauchte, Sohn Liudolfs von Sachsen
Weil sein älterer Bruder Brun in der Normannenschalacht 880 in Ebstorf gefallen war, übernahm Otto (830/840 -912) als jüngerer Sohn Liudolfs die Führung des Liudolfingischen Hauses. (1)
Ottos Schwester Liutgard war mit Ludwig dem Jüngeren, Urenkel Karls und König des Ostfrankenreichs (2) verheiratet. Otto kämpfte im Auftrag Ludwigs weiter gegen die Normannen und Slawen.
Er heiratete Hadwig, die Tochter des Babenbergers Heinrich, der 886 vor Paris nach einem Reitunfall starb. Heinrich war princeps militiae von Ludwig dem Jüngeren.
Heinrichs Vater Poppo entstammte einem fränkischen Adelsgeschlecht, den Robertinern, die über Robert dem Tapferen, Begründer und Ahnherr des Hauses Frankreich wurden. Er wird Namensgeber für Ottos Sohn, Heinrich I.
Auch Hugo Capet (franz. König 987-996, Kapetinger, Sohn von gleichnamiger Hadwig, Tochter Heinrichs I und somit Enkeltochter Ottos des Erlauchten) entstammte über seine väterliche Linie den Robertinern, wie auch die späteren Häuser Frankreichs, Valois und Bourbon. (3) (4)(5) Eine Tochter des Kapetingers Phillip des Schönen mit Namen Isabella wurde Königin von England, in dem sie Eduard II, den ersten Prinzen, der den Titel Prince of Wales erhielt, heiratete. Dieser hatte auch Besitzungen in Frankreich. Ein Sohn, Eduard III, entstammte der französischen Dynastie der Anjou- Plantagenet und wurde Vater der Ahnherren der britischen Häuser Lancaster und York (Rosenkriege). Das Haus Bourbon ist heute noch in der spanischen Königsfamilie und in der Fürstenfamilie Luxemburgs erhalten. (6) (7) Der berühmte Richard Löwenherz (1157-1199) war Abkömmling des Hauses Plantagenet. (7)
Hier zeigt sich, wie die weitverzweigte Heiratspolitik der mittelalterlichen Herrscherfamilien diese später miteinander verbanden.
Zurück zu Otto.
Otto baute seine Stellung aus und wurde 908 Laienabt des Klosters Hersfeld, welches eine Dependance in Quedlinburg unterhielt. Hierzu später mehr, wenn es um Ottos Sohn Heinrich geht. Otto war Gaugraf in Eichsfeld und Thüringen und erweiterte sein Herrschaftsgebiet in Sachsen auch um Thüringen aus. (8)
Ottos und Hadwigs Kinder waren:
Thankmar und Liudolf, die früh starben.
Heinrich I , 876 -936, der uns als Nachfolger und König von Sachsen begegnen wird.
Oda, die in erster Ehe den unehelichen Sohn Kaiser Arnulf von Kärntens (Ururenkel Karls), Zwentibold heiratete. (9) In zweiter Ehe ehelichte sie den Grafen Gerhard der Matfriede.
Tochter Liutgard wurde 4. Äbtissin des von Großvater Liudolf gegründeten Klosters Gandersheim.
Eine weitere nicht eheliche Tochter wurde mit einem Grafen Wido aus Thüringen verheiratet.
(1) http://mittelaltergazette.de/8034/wissenswertes/otto-der-erlauchte-herzog-von-sachsen/
(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_III._(Ostfrankenreich)
(3)
(1) http://mittelaltergazette.de/8034/wissenswertes/otto-der-erlauchte-herzog-von-sachsen/
(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_III._(Ostfrankenreich)
(3) https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_der_Tapfere
(4) https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Capet
(5) https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Valois
https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_III._(England)
https://de.wikipedia.org/wiki/Isabelle_de_France_(%E2%80%A0_1358)
(6) https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Bourbon
(7) https://de.wikipedia.org/wiki/Rosenkriege
(8) https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_L%C3%B6wenherz
(9) https://de.wikipedia.org/wiki/Arnolf_von_K%C3%A4rnten
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_der_Tapfere
(4) https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Capet
(5) https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Valois
https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_III._(England)
https://de.wikipedia.org/wiki/Isabelle_de_France_(%E2%80%A0_1358)
(6) https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Bourbon
(7) https://de.wikipedia.org/wiki/Rosenkriege
(8) https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_L%C3%B6wenherz
Die Familie der von Stade und ihre Abstammung, nebst Verzweigung zu den Walbeckern
Bevor wir uns dem bekanntesten fassbaren Liudolfinger, Heinrich I (876-936) und seiner Familie zuwenden können, müssen die Abstammungen weiterer Männer aus dem Umfeld Heinrichs geklärt werden.
Hierzu gehen wir wieder zurück zu Waltbert (stirbt um 872), dem Sohn des Wicbert (770-834) und somit Enkel des Widukind. Wicbert hatte neben Waltbert, der mit ihm zusammen das Kloster Wildeshausen gründete, noch einen weiteren Sohn, welchen wir aus der Urkunde als Zeugen kennen. Der Kauf des Klosters datiert um 834 und wurde von einem Abbio bezeugt.
Dies kann nicht der Freund Widukinds, der mit ihm zusammen in Attigny 785 getauft wurde, sein. Dieser Abbio war Waffengefährte Widukinds und trat 811 beim Schwur der Grafen an der Eider im Auftrag Karls des Großen und des Dänenkönigs letztmalig auf. Abbio war mit einer noch unbekannten Tochter Widukinds verheiratet, die ich, s. vorige Kapitel, Hilde (Ma th ilde) nenne. Diese wird die Mutter des Immed I und somit die Stammmutter der Immedinger.
Ihr Name, der, wie bereits ausgeführt, aus der Ahnenreihe ihres Vaters (Hilde Eriksdotter war die Mutter Widukinds) stammen kann, wird später über Mathilde Oma und Mathilde Königin sowie Mathilde (955-999) , Tochter Ottos I, Äbtissin von Quedlinburg, erfolgreich weiter gegeben.
Es liegt nahe, dass mit Abbio (Neffe) der Freund und Schwiegersohn Widukinds durch dessen Sohn Wicbert, namentlich geehrt wurde. Abbio war wahrscheinlich mit einer Tochter des Grafen Ostdag, welcher ebenfalls mit Abbios gleichnamigem Onkel den Dänenschwur 811 ablegte, verheiratet. Dies macht zeitlich Sinn, denn Abbios Sohn, Liuthar I, fiel 880 in der Normannenschlacht bei Ebstorf. (1)
Liuthar, der im Namensgut beider Eltern nicht auftaucht, kann als Ehrerbietung auf Kaiser Lothar I (823/ 855), dem Sohn Ludwigs des Frommen und somit Enkel Karls des Großen, zurückzuführen sein, dessen Parteigänger Abbios Vater Wicbert gewesen war. Als Graf von Stade befriedete Abbio einen wichtigen Landstrich im Norden des durch Eroberung ausgedehnten Frankenreichs, das bis nach Esesfeld (Burg von Karl 809 angelegt, heute Itzehoe) reichte und am Fluss Eider an Haithabu und das Dänenreich grenzte. (2)
Liuthar I heiratete Enda, die Tochter Liudolfs von Sachsen und Schwester Ottos des Erlauchten. Sie starb um 879. Die beiden hatten einen Sohn, der wie sein Vater auf den Namen Liuthar II getauft wurde. Er fiel 929 in Lenzen.
Liuthar II heiratete die Hamaländerin Schwanhilde. (3) Sie war die Tochter des Wichmann I von Hamaland. Später wird auch Amalrada, Schwester der Königin Mathilde, in die weitverzweigte Familie der Hamaländer einheiraten. (Everhard von Saxo) Die Hamaländer bildeten mehrere Grafenhäuser, beginnend mit den Meginharden und versippten sich mit den Karolingern. (Wichmann II vh mit Liutgard, Tochter von Arnulf von Flandern) Wichmann II stiftete das Kloster Elten. Seine Tochter Adela fühlte sich um ihr Erbe betrogen und vergiftete ihre Schwester. (s. bereits erzählte Geschichte um Bischof Meinwerk von Paderborn und die Immedinger.)
Liuthar II und Schwanhilde hatten u.a. einen Sohn, mit Namen Heinrich von Stade. Heinrich starb 976. Da Liuthar 929 in Lenzen fiel und seine Mutter Enda bereits um 879 verstorben war (möglicherweise im Kindbett) starb Liuthar mit ca. 50 Jahren. Es ist möglich, dass er an dem großen Feldzug Heinrichs zu Beginn 929 (Heveller, Daleminzier und Böhmen) aus Altersgründen gar nicht teilgenommen hatte, sondern erst wegen der drohenden Auseinandersetzung mit den Redariern in Lenzen von Stade dorthin beordert wurde. Der Titel des Grafen von Stade wurde erst im 12. Jahrhundert fassbar. Stammvater wurde Liuthars Sohn Heinrich der Kahle, Graf von Stade. (4)
(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nsfurth
Ahnentafel von Richard I. von England
https://en.wikipedia.org/wiki/Lothar_I,_Count_of_Stade
- abbio_graf_785
- Wigbert von Verden – Wikipedia
- http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/immedinger_widukind_sippe/waltbert_graf_im_graingau_um_890/waltbert_graf_im_graingau_um_890.html
- Amt Wildeshausen (historisch) – GenWiki
- Alexanderkirche (Wildeshausen) – Wikipedia
- Albion (Heerführer) – Wikipedia
- http://www.dokumentyslaska.pl/saksonskie/001.html
- (2). Burg Esesfeld (Esesfelth, Esesfeldburg) in Itzehoe
- (3)https://en.wikipedia.org/wiki/Lothar_II,_Count_of_Stade
- https://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/udonen_grafen_von_stade/lothar_2_graf_von_stade_929/lothar_2_graf_von_stade_+_929.html
- https://www.wikitree.com/wiki/Hamaland-1
- https://de.wikipedia.org/wiki/Hamaland
- (4)https://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/udonen_grafen_von_stade/judith_von_rheinfranken_graefin_973/judith_von_rheinfranken_graefin_von_stade_973.html
Stade und Walbeck, sowie die Gefallenen von Lenzen
Exkurs
Von Heinrich, dem Kahlen von Stade (910 ? -976) wissen wir, dass er zusammen mit seiner Frau Judith u.a. eine Tochter mit Namen Kunigunde hatte. Diese heiratete den Grafensohn Siegfried von Walbeck und wurde Mutter eines Sohnes mit Namen Thietmar. (Geburtsdaten folgen) Thietmar wird Geistlicher und als Bischoff Thietmar von Merseburg einer der wichtigsten Chronisten zur Schlacht von Lenzen werden.
Er wird erzählen, dass seine beiden Urgroßväter, die beide denselben Namen trugen und als „Liuthare“ ebenfalls von Widukind von Corvey benannt wurden, in dieser Schlacht ums Leben kamen.
Thietmar von Merseburgs Daten(1): 976- 1018
Welche für uns noch unbekannten Beziehungen könnten zwischen den Familien der Grafen von Stade, Walbeck und den Liudolfingern, die zu den Ottonen wurden, bestanden haben? Dieser spannenden Frage werden wir jetzt nachgehen.
Wir kehren zum besseren Verständnis noch einmal zurück zu Enda von Sachsen (verstorben um /vor 879), Schwester Otto des Erlauchten und Ehefrau ihres in der Schlacht bei Ebstorf am 2.2.880 gefallenen Ehemann, Liuthar I von Stade. In dieser Schlacht fiel auch Endas Bruder Brun. (2)
Enda wird somit die Tante des Sohnes Ottos des Erlauchten, des späteren Königs Heinrich I.
Ihr Sohn Liuthar II, welcher 929 in Lenzen fallen wird und Heinrich waren demnach Cousins. Die Abstammung auf beiden Seiten geht über die Liuthare und Abbio (Sohn des Wicbert, Enkel des Widukind), sowie Liudolf, Adila und Brun II (ebenfalls Enkel des Widukind) möglicherweise auf diesen zurück.
Liuthar II von Stade heiratet Schwanhilde von Hamaland. (3)
Das Problem ist die Zuordnung ihrer Kinder und die Verbindung zu den Grafen von Walbeck, die um diese Zeit noch völlig unklar ist und für sehr viel Verwirrung sorgt. (4)
Liuthar II starb eindeutig am 4./5. 9. 929. Sein Sohn Heinrich der Kahle starb 976. Diese Daten sind durch Einträge in den Nekrologen gesichert.
Heinrich (von Stade) kann nur vor 929 geboren worden sein oder im selben Jahr, posthum.
Er wird unter seinem Namensvetter Heinrich I von Sachsen, welcher der Cousin seines Vaters Liuthar II war, eine enge Beziehung zu Heinrich und dessen zweitem Sohn Otto I aufbauen. Heinrich I von Sachsen, der wohl nach seinem Großvater mütterlicherseits, dem Babenberger Heinrich, benannt worden war, wird das weitere Liudolfinger Namensgut in die Stader Familie seines Cousins einbringen. (5a) s. weiter unten
Otto I erhielt seinen Namen sicherlich nach seinem Großvater, Otto dem Erlauchten.
Als Otto nach dem Tode seines Vaters Heinrich I 936 König wird, gibt er das Amt des Heerführers nicht an Wichmann I von Billung, der als älterer von zwei Brüdern ein Anrecht darauf hatte, sondern an dessen jüngeren Bruder Hermann. Das wird für Otto zeitlebens ein Zankapfel zwischen ihm und den Wichmann Söhnen werden. (Otto ist Taufpate von Wichmanns gleichnamigem Sohn, der dadurch, dass seine Mutter Bia die Schwester Mathildes, des Ottos Mutter ist, auch als Vetter Ottos gilt.) Hermann von Billung wird anfangs erfolgreich versuchen, seinen Neffen das Erbe wegzunehmen. (5)(6)
Nach Liuthar II Tod 929 soll Wichmann I das Stader Erbe Heinrichs an sich genommen haben, zusammen mit seinen beiden Söhnen, dem gleichnamigen Wichmann II und Ekbert dem Einäugigen. Als Wichmann 944 starb, waren seine Söhne aber noch zu jung, um dessen Erbe zu übernehmen. Deshalb konnte sich Wichmanns Bruder Hermann schadlos halten, zumal er von Otto I 936 das Amt des princeps militiae anstelle des älteren und erfahrenen Bruders Wichmann I erhalten hatte. (7)
Heinrich von Stade soll gegen Hermann das Erbe der Wichmann Söhne verwaltet haben. Wichmann I, welcher wohl zu den frühen Billungern (Namen: Amelung, Billunc, Bennid) gehörte, die unter Amelung I in Kaufungen Land von Karl dem Großen erhielten, weil sie sich von Widukind abgewandt hatten und wie Hiddi aus ihrem Kernland vertrieben worden waren, starb wie o. erwähnt 944. Wäre Heinrich von Stade um 929 (Tod seines Vaters) geboren, wäre er zu dem Zeitpunkt gerade mal 15 Jahre alt gewesen. Die Wichmann Söhne Wichmann II und Ekbert wurden um 930 /932 geboren. Also können sie selbst noch nichts mit dem Erbe Heinrichs von Stade zu tun gehabt haben.
Wenn die Angaben stimmen, war es Wichmann I allein (900-944), der sich das Stader Erbe angeeignet hatte. Heinrich muss demnach um 920 geboren worden sein. (8) Mit 9 Jahren war er zu jung um sich gegen Wichmann zu wehren und mit 24 alt genug, um das Erbe der Wichmann Söhne im Auftrag Kaiser Ottos zu verwalten. Erst Heinrichs Sohn Lothar-Udo wird die Ländereien 955 zurückerhalten.
Es fällt in diesem großen Zusammenhang auf, dass Heinrich nicht den Namen seines Vaters Liuthar trägt. Das ist ungewöhnlich und lässt darauf schließen, dass Liuthar II von Stade entweder von der üblichen Namensgebung in seiner Familie völlig abgewichen war, was angesichts der Abstammung und des hohen Ansehens seines als Märtyrer geltenden Vaters Liuthar I äußerst ungewöhnlich wäre. (8)
Oder, wie ich vermute, er hatte bereits einen Sohn, der seinem Vater namentlich folgte. Angesichts des Alters von mindestens 50 Jahren bei Liuthars Schlachtentod in Lenzen kann eine solche Konstellation nicht ausgeschlossen werden. Da aber nur Heinrich der Kahle als Nachfolger und Graf von Stade angesehen wird, muss dieser Sohn einer anderen, früheren Beziehung entspringen. Somit war der Name Liuthar bei Heinrichs Geburt bereits belegt und man ehrte mit ihm den Neffen seiner Großmutter Enda, den späteren Heinrich von Sachsen.
Thietmar von Merseburg wird als Nachfahre der wichtigste Chronist und bezeichnete Heinrich von Stade als mit Otto I blutsverwandt.
Das kann zum einen über Heinrichs Großmutter Enda (Ehefrau Liuthars I, Mutter Liuthars II und Schwester Ottos des Erlauchten) möglich sein, da Otto I ja der Enkel Ottos des Erlauchten war und Enda somit seine Großtante.
Die zweite Variante ist die gerade Abstammung von Heinrichs Großvater Liuthar I über Abbio, Wicbert zu Widukind, von dem über Oma Mathilde und die gerade Linie über Immed I zur Tochter Widukinds Ma (th) hilde auch die Mutter Ottos I Mathilde Königin abstammt.
Zusätzlich kommt noch die Abstammung Urgroßvater Liudolfs von Brun II (Eltern Berno und Hasela-Tochter Widukinds) und Adelina (Tochter Ekberts und Ida von Herzfelds) in Betracht. Thietmar spricht von höchster Abstammung seines Großvaters Heinrich von Stade. (8a)
Liuthar II und Schwanhilde hatten weitere Kinder (9) (10): Hildegard (geb um 915) und Siegfried (geb. um 920, jedoch nach Heinrich, sonst wäre er vor diesem der Erbe gewesen.) Als älteste Tochter gilt Gerburg, deren Sohn Dietmar, Bischof von Münster wurde. (1011-1022) (11)
Ab hier wird es etwas undurchsichtig, denn in einigen Quellen taucht nun bereits der Name Walbeck auf.
Walbeck ist eine Grafschaft im Allertal, die erst nach dem Schlachtentod Liuthar I in Lenzen fassbar wird. Wäre dieser der Sohn Liuthars II mit einer unbekannten Frau gewesen, könnte er als der ältere Bruder Heinrichs des Kahlen gelten. Somit wären in Lenzen Vater und Sohn gefallen. (12)
Wie aber kam der Name Walbeck zustande? Von diesem Grafenort ist vorher wenig bekannt, trotzdem sollen sie von hoher Abstammung gewesen sein. Das ist ungewöhnlich. Auch kann Liuthar II von Stade nicht bereits dort ansässig gewesen sein, denn sonst hätte man von seinem in Ebstorf gefallenen Vater von Besitz in der Gegend gewusst. Denkbar ist, das Heinrich die Familie des jüngeren Gefallenen mit der Grafschaft posthum belegt hat, um so die Leistung des erstgeborenen Sohnes seines Vetters Liuthar II von Stade zu würdigen.
Liuthar II von Stade kann möglicherweise auch in Walbeck aufgezogen worden sein, weil er seine Eltern früh verloren hatte. Es finden sich jedoch keine verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Eltern zu Walbecker Onkels oder Tanten. Wäre dies der Fall und hätte er diese beerbt, wäre der Name für ihn rechtens und ein Sohn aus einer ersten Ehe könnte den Namen Liuthar I von Walbeck erhalten haben, was angesichts des Vaters, der bereits Liuthar hieß, auch für Walbeck trotzdem dann nicht chronologisch wäre. Der in Lenzen zusammen mit seinem Vater Liuthar (I von Walbeck und II von Stade), gefallene junge Mann, müsste dann eigentlich Liuthar II von Walbeck sein. Er könnte um 902 geboren worden sein und wäre bei seinem Schlachtentod 27 Jahre alt gewesen.
Für Liuthar II von Walbeck gibt es allerdings gesicherte Hinweise, denn dieser war nachweislich der Sohn des in Lenzen gefallenen Liuthar I von Walbeck. Er erhob sich 941 mit dem jüngeren Bruder Ottos, Heinrich, gegen Otto I, seinen Verwandten, und wurde zunächst von diesem zum Tode verurteilt. Aufgrund der Verwandtschaft und der Fürsprache seiner Freunde wurde er ein Jahr in Haft zu Graf Berthold gegeben, erhielt danach seine Güter zurück und gab dem Grafen Berthold seine einzige Tochter Eilika zur Frau.
Liuthar II von Walbeck (stirbt 964) war mit Mathilde von Arneburg (991) verheiratet (liegt in der Nähe Osterburgs an der Elbe). Sie hatten die Kinder Lothar III sowie Siegfried, der Kunigunde von Stade heiratete und Vater des Geschichtsschreibers Bischof Thietmar von Merseburg wurde, Heinrich und Thietmar, Abt von Corvey, der wohl als Namensgeber für Siegfrieds und Kunigundes Sohn fungierte.
Da Kunigunde als Tochter Heinrichs des Kahlen die Enkeltochter Liuthars II von Stade war, musste Thietmar von Merseburg diesen zwangsläufig als seinen Urgroßvater angeben. Siegfried, als Sohn Liuthars II von Walbeck und Enkel Liuthars I, wurde analog Urgroßvater Thietmars, der lediglich verschwieg, das Liuthar II von Stade auch gleichzeitig sein Ururgroßvater gewesen sein könnte. (Oder es nicht besser wusste.)
Sicher gilt: Liuthar II stiftete nach seiner Begnadigung durch Otto I 942 in Walbeck ein Kloster/Kollgiatsstift. Dort wurde er bestattet. (964) Es brannte 1011 ab und wurde von Bischof Thietmar von Merseburg nach Wiederaufbau zum Fest Allerheiligen 1015 geweiht. (9a)
Liuthars Sarkophag wurde 1932 bei Ausgrabungen gefunden. (9)(10) Heute stehen nur noch Ruinen.
Es ist demnach möglich, dass, wie erwähnt, mit Liuthar II von Stade und Liuthar I von Walbeck Vater und Sohn in Lenzen ihr Leben verloren. Da Heinrich von Stade nach diesem älteren Bruder und mit Schwanhilde auch von einer anderen Mutter geboren wurde, erhielt er den Namen des Neffen seiner Großmutter Enda.
Die enge Beziehung Heinrichs von Stade zur Liudolfinger Königsfamilie setzte sich in der Namensgebung bei seinen eigenen Kindern fort. (11) (12) Dazu kommen wir gleich.
Liuthar II von Stade und Liuthar I von Walbeck waren somit nachweislich zwei verschiedene Personen.
Liuthar II von Stade als Sohn des bei Ebstorf gefallenen Liuthar I von Stade in Abstammung zu Abbio und Wicbert, somit Ururenkel des Widukind wurde Vater des Grafen Heinrich der Kahle von Stade, der wiederum Vater von Kunigunde von Stade wurde. (Mutter des Chronisten Bischof Thietmar von Merseburg)
Liuthar II von Walbeck, als Sohn des 929 bei Lenzen gefallenen Liuthar I muss deshalb bereits vor 929 geboren worden sein. Von seiner Mutter wissen wir nichts. Er wäre ein Neffe Heinrichs des Kahlen gewesen und stiftete 942 das Kloster, nachdem er von Otto I nach der Verschwörung gegen diesen begnadigt worden war.
Heinrich der Kahle von Stade heiratete die Konradinerin Judith von der Wetterau.
Deren Bruder war Herzog Hermann von Schwaben, ein enger Vertrauter Ottos I. Judiths Vater war Udo von der Wetterau (900-949), Sohn von Gebhard II von Lothringen. ((13a) Gebhard und seine Enkeltochter Judith stammten aus der Familie des Kaisers und Karolinger Nachfahren Arnulf von Kärnten (Großvater Ludwig der Deutsche, Sohn Ludwigs des Frommen und Enkel Karls des Großen). Arnulf von Kärnten hatte als unmündigen Sohn den letzten Karolinger des Ostfränkischen Reiches Ludwig das Kind. (911)(13b)
Udo von der Wetterau, Judiths Vater, war verheiratet mit einer Tochter des Grafen Heribert von Vermandois, welcher durch seinen Vater Pippin ein Enkel Bernhards, König von Italien gewesen war. Dieser war ein Sohn Karlmanns und Enkel Karls des Großen. Somit stammte Judith mehrfach von den Karolingern ab. Udos Name wird später mit Heinrichs Namen als Begründer der Udonen in Stade in Verbindung gebracht. Judith trägt den Namen der Ehefrau Ludwigs des Frommen (einziger überlebender Sohn Karls des Großen und Kaiser nach seinem Vater). (13c)
Die Kinder von Judith und Heinrich:
Heinrich (stirbt 1016)
Lothar-Udo (Namensgleichheit zu den Vorfahren Heinrichs und Judiths, stirbt 994)
Siegfried (1037)
Gerburg
Hathui (Form von Hatheburg oder Hadwig 1013, Sie wurde 12 jährig bereits Äbtissin vom Kloster Heeslingen, wo Heinrich und seine Frau bestattet wurden. Dies geschah durch Altersdispens von Seiten Kaiser Ottos I.
Kunigunde (997), welche Siegfried von Walbeck heiraten und die Mutter des Chronisten Bischof Thietmar von Merseburg werden wird. (14)
Die Namen der Kinder Heinrichs I von Sachsen:
Heinrich von Sachsen heiratete in erster Ehe um 906 Hatheburg von Merseburg, eine reiche Erbin. Sie hatten einen Sohn: Thankmar, Kosename Tammo, von dem wir in tragischer Weise noch hören werden.
Heinrich verstößt Hatheburg (Begründung folgt) und heiratet in zweiter Ehe 909 die erst vierzehnjährige Mathilde, die von ihrer gleichnamigen Großmutter im Kloster Herford erzogen wird. Beide gelten als Immedinger und somit als Nachfahren Widukinds. (Dies wurde bereits herausgearbeitet.)
Mathilde und Heinrich hatten folgende Kinder:
Otto, geb 912, (15)
Gerberga (16) geb 913
Hadwig (17) geb 914 /920
Heinrich (18) geb 921
Brun (19) geb 925
Über das Leben der Familie erfahren wir in einem eigenen Kapitel. Heinrich kann als Urheber der Schlacht von Lenzen gesehen werden.
Auffällig sind hier jetzt nur die Namen der Töchter, Gerberga und Hadwig, die sich im Namensgut der Familie Heinrichs von Stade wiederfinden. Hadwig ist eine Ehrung an Heinrich I Mutter, der Ehefrau Ottos des Erlauchten, Hadwig, Tochter des Babenbergers Heinrich. Gerberga als Liudolfingischer Leitname kann sehr weit zurückgehen, nämlich auf Gerperga, der vermuteten Mutter Idas von Herzfeld, deren Tochter Adila die Stammutter der Liudolfinger wurde.
Mit Heinrich und Otto, sowie Brun geht man auf Otto den Erlauchten zurück und mit Brun weiter in die widukindische Vergangenheit.
Auch der älteste Sohn Heinrichs I mit Hatheburg von Merseburg erinnert namentlich an den früh verstorbenen Bruder Ottos des Erlauchten, Thankmar.
Allgemeines:
Heinrich der Kahle von Stade nahm seinen Sitz in Harsefeld um 969. Die Grafschaft zu beiden Seiten der Elbe war von 944- 1144 im Besitz der Udonen. Die Nachkommen Heinrichs zogen dann nach Stade um und nannten sich Grafen von Stade.
Der Name Udo geht, wie bereits erwähnt, auf den Vater der Ehefrau Heinrichs, Judith, Udo von der Wetterau, zurück. Da der Name Lothar mit diesem später kombiniert wurde und Heinrichs Großvater sowie Vater Liuthar I und Liuthar II als Kriegshelden in den Schlachten von Ebstorf 88o und Lenzen 929 fielen, lässt sich Heinrichs Abstammung von diesen beiden anhand des Vornamens Lothar festlegen. Ob Heinrich in der Gegend um Stade aufgewachsen war oder aus dem Gebiet Ostsachsens kam, muss zunächst offen bleiben.
Die Beziehung zu Walbeck kann dabei eine Rolle spielen. Allerdings haben wir gesehen, dass Liuthar II von Stade und Liuthar I von Walbeck zwei Personen waren, die beide jeweils Söhne hatten. Liuthar I von Walbeck nannte seinen Sohn Liuthar II. Liuthar II von Stade war Vater von Heinrich, der den Namen Liuthar erst an seinen eigenen Sohn Lothar-Udo weitergab. Ob der Zusatz „der Kahle“ bei Heinrich etwas mit einem Klosteraufenthalt zu tun hat, ist möglich, denn Heinrich hatte seinen Vater früh verloren. Seine Mutter Schwanhilde lebte aber noch. Die Familien Stade und Walbeck vererbten nicht nur ihre Leitnamen, sondern ehelichten untereinander, wie Kunigunde und Siegfried bewiesen. (20)(21)
Der Name Harsefeld oder Rossenfeld geht zurück auf das Wort Ross für Pferd:
Feld der Pferde. (22)
Die Geschichte Thietmars von Merseburg , der Udonen und der Wikinger: https://ruprecht.art.blog/2018/04/25/thietmars-ritt-nach-rosenfeld/
Ausgrabungen an der Schwinge belegen laut Spiegelbericht (24) von 2014 eine mittelalterliche Burg, deren Hölzer um 673/674 geschlagen wurden. Wir wissen, dass sich die Sachsen (Geschichte von Hengest und Horsa) von dort im 4. und 5. Jahrhundert auf den Weg nach England gemacht hatten. Dort sind die Angelsachsen (Sachsen und Angeln) belegt. (Wessex, Sussex, Essex)
Die an der Schwinge ausgegrabene Burg hatte die Größe eines Fußballfeldes.
In nächster Nähe fand man eine etwas kleinere Burg. Friedhöfe mit etwa 70 Gräbern fand man in Riensförde 1,5 km entfernt, als es als Bebauungsgebiet ausgewiesen wurde. Leider wurde der Bereich inzwischen überbaut.
Die Burg an der Schwinge endete um 928/929, so die jüngsten Datierungen der Bauhölzer laut Ausgrabungsleiter Schäfer. Um diese Zeit soll ein Lüder V aus dem späteren Geschlecht der Stader Grafen im brandenburgischen Lenzen in der Schlacht gefallen sein.
Um wen es sich dabei handelt, muss nicht mehr erläutert werden. Angesichts der Holzdatierungen entfiel die jahrelange Annahme, bei der Burg handele es sich um eine Schwedenschanze aus dem 30jährigen Krieg. Diese beiden Burgen waren und sind um Jahrhunderte älter.
Um 900 wurde bereits begonnen den Spiegelberg in Stade (heutige Altstadt) aufzuschütten, auf dem die Stader Grafen später ihre Burg errichteten.
Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Herkunft Liuthar II tatsächlich archäologisch bewiesen werden kann und es sich bei seinem Wohnsitz um die beiden Burgen an der Schwinge gehandelt hat. Die Schwinge ist ein 28,7 km langer Nebenarm der Elbe und fließt zur Hansestadt Stade, die auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurückblicken kann. Im Stader Hafen wurden bei Baggerarbeiten Inschriftenschwerter aus dem 8./9. Jahrhundert mit dem Namenszug Ulfbehrt gefunden. (25) Diese Inschriftenschwerter aus dem Hochmittelalter bis ins 10./11. Jahrhundert wurden überall in Europa teils in Flüssen gefunden. So auch die Schwerter aus der Schwinge. In der Nähe des Stader Ortsteils Groß Thun wurde 2009 eine frühmittelalterliche Wallburg entdeckt, die auf einem erhöhten Punkt der Stader Schwingewiesen lag und als Ohle Dörp bezeichnet wird. Dort wurden archäologische Gegenstände aus der Zeit zwischen dem 8. Und 10. Jahrhundert gefunden. (26)
Daneben wissen wir von Thietmar von Merseburg um 1012: Von den Unsrigen aber fielen am 5. September mit vielen anderen zwei meiner Urgroßväter namens Liuthar, treffliche Ritter von Hoher Abkunft …“
Papst Eugen III schrieb 1151 an den Bischof Hartwig d. Ä, der bis zu seinem Tod 1168 Erzbischof von Bremen war. Dieser war der letzte männliche Abkömmling aus dem Stader Grafenhaus der Udonen. Seine Schwester Richardis von Stade war mit Hildegard von Bingen gut bekannt. (27a)
Anfang und Ende der Udonen, mit Liuthar I und seinem Tod in Ebstorf, seinem Sohn Liuthar II und dessen Tod in Lenzen sowie Heinrich dem Kahlen, der eng mit Heinrich von Sachsen und seinem Sohn Otto I verbandelt und verwandt war, sind somit belegt.
Heinrich ließ 969 eine Burg in Harsefeld bauen, die um 1000 von seinem Sohn Heinrich II in ein Stift umgewandelt wurde. Die Familie zog nach Stade. Das Stift wurde wahrscheinlich zur Familiengrabstätte.
1016 wurde Heinrichs I zweiter Sohn Siegfried Graf von Stade.
1987 wurden das Areal der Burg Harsefeld und das Kloster archäologisch untersucht. Es wurden am Platz der Kirche 28 Gräber aus früh-und hochmittelalterlicher Zeit gefunden: 19 Männer, 5 Frauen, davon eine hochschwanger und 4 Kinder. Die Gräber waren auf unterschiedliche Weise ausgestattet. Nach dem Bericht von Dieter Ziermann handelt es sich um die Familiengrabstätte der Udonen. Der bekannte Geschichtsschreiber Annalisto Saxo schrieb, dass noch im 12. Jahrhundert die Grablegen Heinrichs II und seiner Frau Mathilde als Wallfahrtsstätten besucht wurden. (27)
Fügt man alle Puzzleteile zusammen kann angenommen werden, dass die Burg an der Schwinge in der untersuchten Zeit um 929 von Rittern bewohnt worden war und als Wohnsitz von Liuthar II von Stade gelten kann. Anhand der Holzdatierungen ist es möglich, dass bereits sein Vater Liuthar I und sein Großvater Abbio dort lebten. Möglicherweise zog Schwanhild, Tochter von Wichmann von Hamaland, die Mutter Heinrichs, mit diesem und ihren anderen Kindern nach seinem Tod an einen anderen Ort, vielleicht auch in ein befestigtes Haus in die spätere Stadt Stade. Heinrich wurde möglicherweise in einem Kloster erzogen, daher der Namenszusatz, der Kahle. Andererseits kann das auch auf fehlenden Haarwuchs hinweisen. Le chauve bedeutet Glatzkopf, kahl. Wir kennen den Namenszusatz auch von Karl dem Kahlen, jüngster Sohn Ludwigs des Frommen mit seiner zweiten Frau Judith. (28)
Leider wurde der Friedhof in Riensförde zerstört. Es ist nicht möglich, das Liuthar II sofort in der Familiengrabstätte in Harsefeld bestattet wurde. Die Burg wurde ja erst 967 gebaut. Wenn die in Lenzen gefallenen adligen sächsischen Soldaten nicht am Rand des Schlachtfeldes bestattet wurden, kann es sein, dass sie in ihre Heimat überführt wurden. Bei Verwandten des Königs wäre das möglich. Andererseits hielt Heinrich I am 16.09. 929 seinen Hoftag in Quedlinburg am Harz ab und man wird kaum die toten Soldaten mitgenommen haben. Lenzen war Slawenland und die Toten würden in nicht geweihter Erde ruhen. Die Linonenburg wurde nach der Schlacht am 5.9.929 zerstört. Um 950 wurde sie an der Stelle der heutigen Steinburg in Lenzen wieder aufgebaut. Um 1040 errichtete Gottschalk ein Kloster in Lenzen. Der Grund war mit Sicherheit, für die verstorbenen Soldaten zu beten und es ist anzunehmen, dass zumindest die einfachen Soldaten in Lenzen bestattet wurden.
Liuthar II könnte auf dem Friedhof in Riensförde seine letzte Ruhe gefunden haben. Eventuell hat Heinrich seinen Vater nach Fertigstellung der Burg in Harsefeld in die Kirche bringen und dort bestatten lassen. Das wäre der Stellung des Vaters angemessen gewesen. Die besondere Art der Grablegen dort lässt so etwas auch vermuten. Eine Untersuchung der männlichen Skelette auf Kampfspuren könnte näheren Aufschluss geben.
(1) https://www.wagner-b.de/PDF/Die_Chronik_Thietmars_von_Merseburg.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Thietmar_von_Merseburg
(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Ebstorfer_M%C3%A4rtyrer
(3) https://gw.geneanet.org/u649578?lang=de&n=van+hamaland&oc=0&p=everhard+saxo
(5a) https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Stade
(5b) https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_I._(Schwaben)
(5c) https://de.wikipedia.org/wiki/Udo_I._von_der_Wetterau
(5d) https://www.wikitree.com/wiki/Konradiner-5
(5) https://de.wikipedia.org/wiki/Wichmann_II.
(6) https://de.wikipedia.org/wiki/Wichmann_I.
(8) https://de.wikibrief.org/wiki/Henry_I_the_Bald%2C_Count_of_Stade
https://gw.geneanet.org/u649578?lang=de&iz=461&p=lothar+ii&n=von+stade
(8a) https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Stade
(9a) https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftskirche_Walbeck
https://romanik-strasse-erleben.de/sarkophag-in-walbeck/
http://www.rettinger.tv/88458.html
(11) https://www.walbeckimallertal.de/lesson/mittelalter/
(13) https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Walbeck
https://www.walbeckimallertal.de/
https://gw.geneanet.org/stiny1?lang=en&n=van+stade&oc=0&p=lothar+ii
(13a) https://de.wikipedia.org/wiki/Gebhard_(Lothringen)
(13b) https://de.wikipedia.org/wiki/Konradiner
(13c) https://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_I._(Vermandois)
(13d) https://de.wikipedia.org/wiki/Judith_(Kaiserin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vermandois
http://gedbas.de/person/show/1165399313
https://familypedia.fandom.com/wiki/Judith_von_der_Wetterau_(aft920-973)
(14) https://www.werelate.org/wiki/Person:Judith_Von_Wetterau_%281%29
(15) https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Ostfrankenreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_I._(HRR)
(16) https://de.wikipedia.org/wiki/Gerberga_(Frankreich)
(18) https://de.wikipedia.org/wiki/Hadwig_von_Sachsen
(18) https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Bayern)
(19) https://de.wikipedia.org/wiki/Brun_(K%C3%B6ln)
(20) https://de.wikipedia.org/wiki/Udonen
(21) https://de.wikipedia.org/wiki/Harsefeld
(22) siehe im Text Geschichte der Udonen
(23) Schwedenschanze (Stade) – Wikipedia
(25) https://de.wikipedia.org/wiki/Schwinge_(Elbe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ingelrii#Inschriftenschwerter
(26) https://de.wikipedia.org/wiki/Ohle_D%C3%B6rp
(27) http://www.archaeologie-stade.de/geschichtsspuren/graeber_in_harsefeld/
(27a) https://de.wikipedia.org/wiki/Hartwig_I._(Bremen)
(28) https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/franzosisch-deutsch/l%C3%A0%2C+le+chauve